Studie der Uni Halle: Pflanzen beeinflussen unser Klima

Das Klima reguliert das Pflanzenwachstum, aber das Klima wird auch von Pflanzen beeinflusst. Je nach Pflanzenmix haben Ökosysteme sogar einen starken Einfluss auf das Klima in Europa, wie eine Studie der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) im Journal „Global Change Biology“ zeigt. Die Forschenden verknüpften Satellitendaten mit rund 50.000 Vegetationsaufnahmen aus ganz Europa. Gut fünf Prozent der regionalen Klimaregulation lassen sich durch die Pflanzenvielfalt vor Ort erklären. Die Analyse zeigt zudem, dass die Effekte von vielen weiteren Faktoren abhängen. Pflanzen beeinflussen das Klima, indem sie Sonnenlicht reflektieren oder durch Verdunstung ihre Umgebung abkühlen.
„Pflanzen und Klima stehen in einem äußerst komplexen Verhältnis zueinander: Das Klima hat einerseits einen erheblichen Einfluss auf das Pflanzenwachstum und auch auf die Merkmale der Pflanzen, etwa die Wuchshöhe, Dicke der Blätter oder Wurzeltiefe. Andererseits beeinflussen Pflanzen auf vielfältige Weise die klimatischen Bedingungen“, sagt Dr. Stephan Kambach vom Lehrstuhl für Geobotanik an der MLU. Reflektieren Pflanzen zum Beispiel viel Sonnenlicht, sammelt sich vor Ort weniger Wärme. Pflanzen können ihre Umgebung auch abkühlen, indem sie Wasser verdunsten lassen. Außerdem können Pflanzen große Mengen des Treibhausgases Kohlenstoffdioxid binden.
Bislang wusste man laut Kambach allerdings nur wenig darüber, wie stark die verschiedenen funktionellen Pflanzenmerkmale, zum Beispiel die Beschaffenheit von Blättern und Wurzeln, auf das Klima einwirken. Um diese Wissenslücke zu schließen, verknüpfte ein internationales Team unter Leitung der MLU die regionalen Daten aus Satellitenbeobachtungen mit lokalen Erhebungen zu Pflanzen und Pflanzenmerkmalen an knapp 50.000 Orten in Europa. „Uns war es dabei wichtig, Flächen aus sehr unterschiedlichen Habitaten zu kombinieren. Unsere Daten umfassen deshalb Angaben aus Nadel-, Laub- und immergrünen Laubwäldern sowie verschiedenen Strauch- und Offenland-Formationen“, erklärt Prof. Dr. Helge Bruelheide, der Seniorautor der Studie und Leiter der Arbeitsgruppe Geobotanik an der MLU.
„Wir können zeigen, dass ein bedeutender Anteil der beobachteten klimaregulierenden Prozesse durch Unterschiede in den funktionellen Merkmalen der Pflanzen vor Ort erklärt werden kann. Es kommt also stark darauf an, welche Pflanzen in welcher Menge in einem Ökosystem wachsen“, so Kambach weiter. Allerdings unterschieden sich die Effekte zwischen einzelnen Ökosystemen stark, zum Beispiel zwischen immergrünen Nadel- oder Laubwäldern. „Wir konnten insgesamt dennoch nachweisen, dass eine höhere Pflanzendecke weniger Sonnenlicht reflektiert und größere Blätter mit einer höheren Verdunstung sowie mehr gebundenem Kohlenstoff einhergehen“, sagt Biologe Kambach.
Die Studie ist ein zentrales Ergebnis des europäischen Forschungsprojekts „FeedBaCks“, das die Rückkopplungsmechanismen zwischen Biodiversität und Klima sowie deren Folgen für die Menschen untersucht. Koordiniert wird es von der Universität Zürich. Partner sind neben der MLU die Universitäten Brno (Tschechische Republik), Frankfurt/Main und Grenoble (Frankreich) sowie die Eidgenössische Forschungsanstalt (WSL, Schweiz), die Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung und das Stockholm Resilience Center (Schweden).
„Unsere Studie liefert auch wichtige Ansatzpunkte für den Naturschutz und die Politik. Bei der Planung von Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels sollten die potenziellen Auswirkungen und Rückkopplungen der biologischen Vielfalt berücksichtigt werden“, sagt Helge Bruelheide abschließend.
Weitere Informationen unter: www.biodiv-feedbacks.org
Studie: Kambach S. et al. Climate regulation processes are linked to the functional composition of plant communities in European forests, shrublands, and grasslands. Global Change Biology (2024). doi: 10.1111/gcb.17189





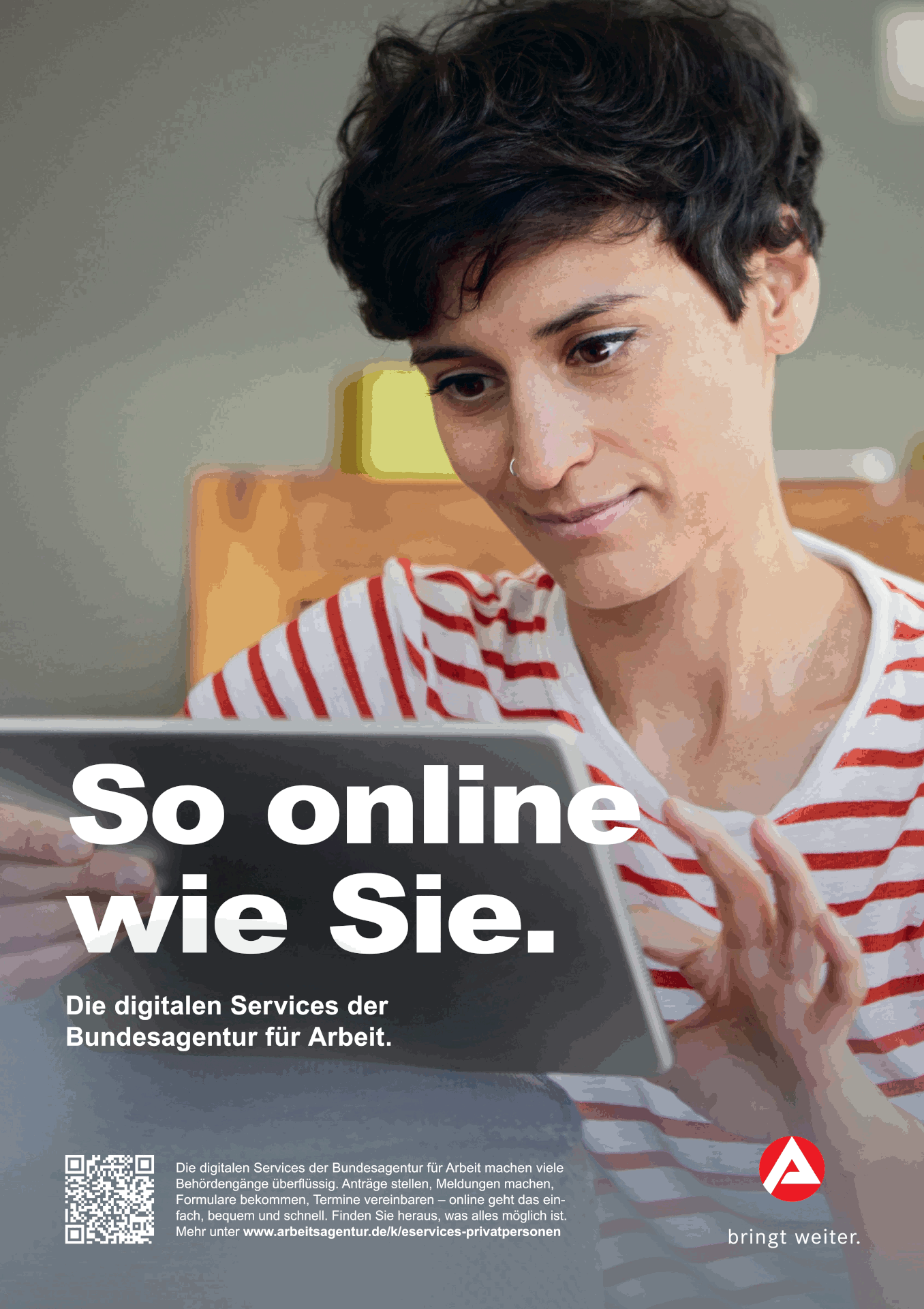






„Studie der Uni Halle: Pflanzen beeinflussen unser Klima“
Was,das hat die Uni Halle echt jetzt in einer Studie belegt. Also ist jetzt ein Witz oder? Das wussten sogar schon unsre (Ur-,Ur-,Ur-)Vorfahren.
Nur die Überschrift gelesen?
Und nein zu: “ Das wussten sogar schon unsre (Ur-,Ur-,Ur-)Vorfahren.“
Die Erkenntnisse der Uni-Studie ist nicht neu.
Seit 180 Jahren soll das bekannt sein?
Dann, lieber Detlef, benenne doch mal die Person(en) und Studien, die das damals bereits bewiesen hätten.
Du brauchst nicht wirklich suchen, wenn es so wäre wüsste ich davon!
Hat man mal wieder festgestellt, dass in unserer Welt alles mit allem zusammenhängt? Da waren unsere Urahnen schon mal schlauer.
Für diese bahnbrechende Entdeckung gibt’s bestimmt den Nobelpreis. Wissen das unsere Grünen auch schon?
In min. 95% der Forschungsarbeiten geht es oft nur um weitere Details zu einem bereits bekannten Thema und weniger um bahnbrechende Entdeckungen. Die Arbeit beschreibt auch nicht die bloße Entdeckung, dass Pflanzen Bäume und Grünflächen wichtig für die Umwelt und das Klima sind, sondern vielmehr die quantitativen Effekte. Also das „wieviel“.
Wenn das alles so selbstverständlich ist, wie es hier immer dargestellt wird, warum hauen wir trotzdem alles Grün in dieser Stadt weg und befürworten das auch noch ?
So blödsinnig ist das nichtmal.
Die bloße Erkenntnis, dass Bewuchs und Mikroklima zusammen hängen wäre tatsächlich keine revolutionäre Entdeckung – auch ich hab das so bereits im Abitur gelernt. Interessant ist an der Arbeit dagegen, dass eben auch die Beziehungen zwischen Bewuchs, Mikroklima und den verschiedenen Arten in der Arbeit quantitativ beschrieben werden. Und dieses „wieviel“, also die Zahlen zu diesem Thema, sind neu. Die Arbeit definiert das Fachgebiet natürlich nicht neu – auch andere haben daran schon gearbeitet. Die Studie wird auch keinen Nobelpreis einbringen, aber in min. 95% der Forschungsarbeiten geht es eben auch oft nur um weitere Details zu einem bereits bekannten Thema. Die Arbeit beschreibt eben nicht die bloße Entdeckung, dass Pflanzen Bäume und Grünflächen wichtig für die Umwelt und das Klima sind.
Aus der Studie:
„In particular, habitats covered by snow for longer periods (i.e., alpine habitats) showed the highest proportion of reflected solar irradiation […]“
Breaking news quasi …