Jahresausstellung: Halles Kunst-Studenten zeigen ihre Werke

Sie ist ein Highlight des Studienjahres: die Jahresausstellung der Kunsthochschule Burg Giebichenstein. Auch in diesem Jahr zeigten die halleschen Kunststudenten wieder ihre neuesten Werke. An verschiedenen Orten in der Stadt gab es dabei Kunst zu sehen, so im Volkspark oder am Campus Design.
So haben sich Burg-Studenten zum Beispiel Gedanken um die tropfenden Kännchen gemacht und eine Alternative entwickelt, ein Kännchen mit zwei Ausgüssen. Jetzt warten die Entwickler auf den großen Wurf, nämlich eine Firma, die die Idee in Serie umsetzt. Auch neue Designs für Schüssel und Vasen oder für Möbel haben die Studenten entwickelt, ebenso eine Tasche aus dem Kombucha-Pilz als vegane Alternative zu Leder.
Ebenfalls an der Burg beheimatet sind die Spielzeugdesigner. Hier erarbeitet man gemeinsam mit halleschen Kindereinrichtungen, aber auch durch Hilfe großer Spielehersteller, neue Spielmittel für die Kinder. Oder für Erwachsene. Denn auch die betätigten sich gern, zum Beispiel in einem Laufrad – das an das Exemplar aus dem Hamster-Käfig, nur in groß, erinnert. Eine große Kugelbahn war aufgebaut. „Leider kaputt gespielt“, verwies allerdings ein Hinweisschild. Gespielt werden konnte stattdessen an einem Klangautomat. Durch eine Kurbel konnten verschiedene Instrumente bedient werden. Eine andere Apparatur erzeugte Klänge durch Wassertropfen. Die prasselten auf Membranen herab. Und je nach Höhe und Dicke – die übrigens durch eine an ein Mischpult erinnernde Apparatur gesteuert werden konnten – veränderten sich die Töne.
Auch Gesellschaftskritisches gab es zu sehen. So den „Popomat“. Der bot die Möglichkeit, für 50 Cent ein Foto seines Gesäßes zu machen. Zu verstehen war das als Kritik an der Selfie-Fotoflut in den sozialen Netzwerken. Ein Automat war dazu da, Datenträger wie Festplatten und CDs zu zerstören.
Wesentliche Abstraktere Dinge gab es am Campus Kunst in der Burg Giebichenstein zu sehen. Nicht selten standen die Besucher vor den Kunstwerken und haderten mit der Bedeutung. Da gab es eine Installation aus an Fäden aufgehängten Schuhen, hänge Fenster mit Fingerabdrücken oder einen aufgereihten Stapel Holzscheite. Die Zeiten von international gefeierten Künstlern wie Willi Sitte, Wolfgang Dreysse oder Bernd Göbel sind vorbei. Und auch die Zeiten, in denen die Absolventen von ihrer Kunst leben konnten. Gerüchten zufolge soll gerade Mal ein unterer einstelliger Prozentanteil am Ende wirklich sein Brot mit der Kunst verdienen können. „Die Kunst verkommt mehr und mehr zur Ausdrucksweise einer kleinen elitären Schicht „Verstehender“, welche es sich zur Aufgabe gemacht hat auch den größten Unsinn der Kunststudenten schönzureden“, meinte deshalb auch ein guter Kenner der Hochschule gegenüber dubisthalle.de.

In dieses Bild passt auch das Sieger-Exponat des Kunstpreises der Stiftung der Saalesparkasse, Paul Saynisch. Manch einen Besucher mag die mit 2.500 Euro dotierte Arbeit „Und es schält sich ein König aus dem laublosen Fleisch“ eher an ein unaufgeräumtes Kinderzimmer erinnert haben mit Kreidegekrakel auf dem Boden.
Die Jury meint dagegen zum Sieger: Die raumgreifende Installation von Paul Saynisch verwirrt: Das Licht der Neonröhren flackert schnell, die Fenster sind mit einer Schicht weißer Farbe überzogen, die Tür ist gepolstert. Auf dem Boden ist billiger Teppich ausgelegt, vom Künstler mit farbiger Kreide beschrieben. Reste der Kreide liegen noch herum. Die sorgsam gerahmten Grafiken hängen nicht an der Wand, sondern lehnen an ihr, auf dem Boden abgestellt. Ein Rahmen ist umgefallen. In der Mitte des Raumes befindet sich ein Sockel mit einer seltsam anmutenden Plastik, ein gewissermaßen im Laufen gebärendes Schwein mit Reiter. Das Flackern der Neonröhren macht nervös. Was ist hier eigentlich los? Was gehört zur Ausstellung, was nicht? Ist die Zigarettenschachtel auf dem Fußboden absichtsvoll platziert?
Preisträger Paul Saynisch zeigt mit dieser Installation sein Können, er präsentiert Plastiken und Grafiken, stellt aber gleichzeitig alles in Frage. Er offenbart sich, den Arbeitsprozess und seine Reflexion der Ausstellungssituation. Er arbeitet gegen den Raum — und bezieht dabei alle Aspekte des Raumes ein. So entsteht ein neuer Raum, der Brechungen und Widerstand beinhaltet und der die Ausstellungssituation selbst thematisiert. Dies hat die Jury überzeugt. Der Raum als Ganzes enttäuscht und verstört den Betrachtenden in seiner Hässlichkeit und klaustrophobischen Vereinnahmung, gleichzeitig fasziniert die Unmittelbarkeit und Radikalität.
















































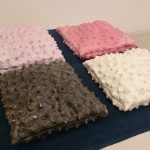


















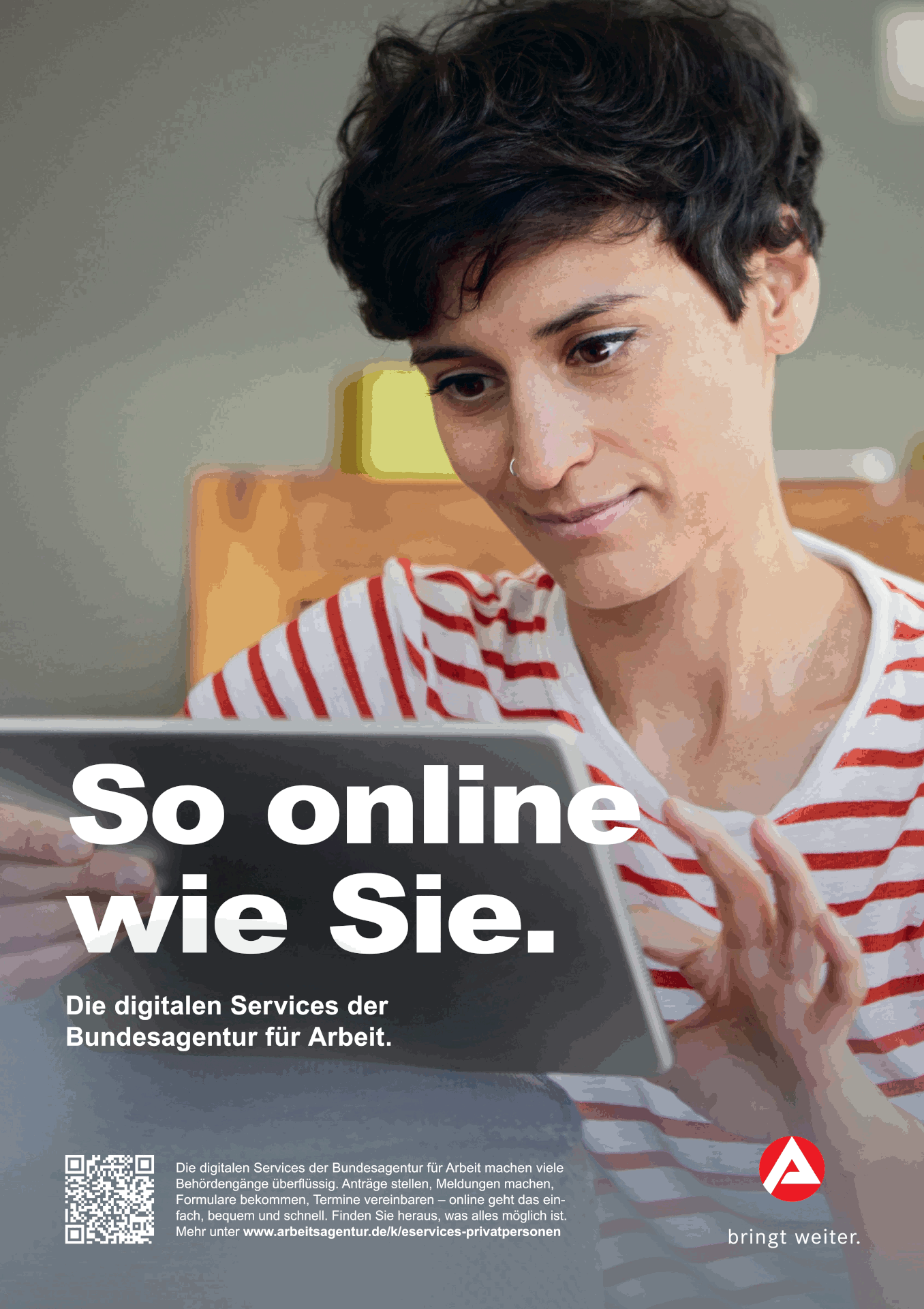




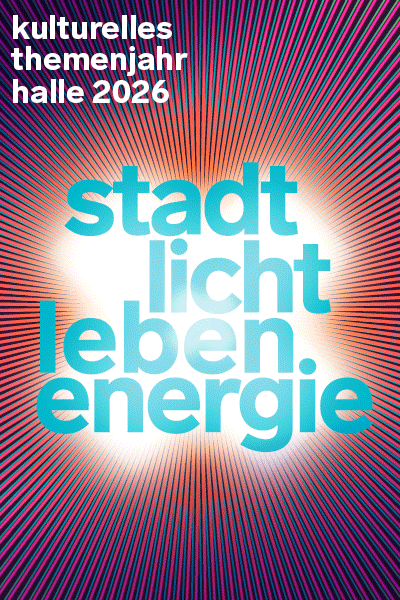



Neueste Kommentare