Aktionswoche für Kinder aus suchtbelasteten Familien – Im Gespräch mit den Veranstaltern: „Kinder tragen niemals die Schuld an einer Suchterkrankung!“

1,3 Millionen Menschen gelten in Deutschland als Glücksspielsüchtig, mehr als drei Millionen gelten als Suchtgefährdet. Viele der Glücksspielsüchtigen Personen haben Kinder, welche unter der Sucht leiden. Genau um diese dreht sich die „Aktionswoche für Kinder aus suchtbelasteten Familien“ die am vergangenen Sonntag in Halle und dem Saalekreis gestartet ist. Mit zahlreichen Veranstaltungen sollen von dem Thema Betroffenen niederschwellige Angebote aufgezeigt werden, wie die Behandlung der Sucht in Angriff genommen werden kann. Denn Spielsucht ist eine Krankheit.
In Halle leben nach Hochrechnungen rund 8.000 Kinder und Heranwachsende in suchtbelasteten Familien, so Stefan Börner vom Glücksspielfrei e. V. in Halle (Saale). Börner leitet auch die Selbsthilfegruppe „Game Over“ in der Saalestadt. Deutschland habe zwar schon ein in Europa einzigartiges und vor allem niedrigschwelliges Hilfs- und Unterstützungsangebot, es mangele jedoch stark an der Aufklärung über die Gefahren und Folgen einer Suchterkrankung. Nach Werbung für Suchtmittel, zum Beispiel im Fernsehen, müsste direkt im Anschluss auf die Gefahren hingewiesen werden, so Börner. Im Bezug auf die Folgen für Kinder in suchtbelasteten Familien rief Börner zu mehr Aufmerksamkeit von Erwachsenen auf: „Es ist die Aufgabe der Erwachsenen, auf Hinweise von den Kindern zu achten und diese vor allem auch ernst zu nehmen.“ Denn die Gefahr, dass Kinder aus suchtbelasteten Familien bleibende Schäden davontragen, sei hoch: „Rund ein Drittel weisen ein erhöhtes Risiko auf, später selbst süchtig zu werden. Bei einem weiteren Drittel besteht ein erhöhtes Risiko für psychische Erkrankungen.“
Claudia Hammer von der Fachstelle Suchtprävention Saalekreis spricht von Schuld und Scham wenn es darum geht, warum es so schwer sei, Suchtprobleme offen anzusprechen. In den meisten betroffenen Familien gebe es drei ungeschriebene Regeln: Fühle nichts – Rede nicht – Vertraue niemandem. Eine weitere Herausforderung, Suchtprobleme in Familien anzusprechen, bestehe darin, diese überhaupt erst einmal zu erkennen, denn: „Kinder entwickeln sehr schnell eigene Strategien um das Thema zu umschiffen und Verhaltensänderungen sind immer ein schleichender Prozess, der nicht sofort auffällt.“, so Hammer. Die Kinder flüchten sich in Rollenmodelle um die Belastungen in der Familie zu verdrängen. Man unterscheidet hier in den Helden, das schwarze Schaf, das unsichtbares Kind und den Clown. Jedes Rollenmodell habe Auswirkungen auf das Verhalten des Kindes und es gebe Signale, die es zu erkennen gelte. Für viele Kinder sei der Aufenthalt außerhalb der eigenen Familie oft ein Segen, zum Beispiel der Schulbesuch. „Was haben die Kinder und Jugendlichen in suchtbelasteten Familien während der Coronazeit gemacht? Was haben die Kinder erlebt, die längere Zeit nicht in die Schule gehen konnten, und diese Zeit dauerhaft mit den Suchtkranken durchleben mussten?“, fragt Hammer.
„Sucht ist eine Krankheit, die behandelt werden muss. Mit einem ,So ich mache jetzt mal Schluss‘ ist es nicht getan.“, sagt Kathrin Jäger, Suchtkoordinatorin der Stadt Halle (Saale). Daher sei es unabdingbar niedrigschwellige Angebote vorzuhalten. Auch anonyme Online-Angebote helfen hier. Vor allem komme es aber auf die Prävention an. „Prävention ist der Schlüssel, Resilienz zu entwickeln.“, so Jäger. Hierbei spiele auch die gute Zusammenarbeit der vielen am Hilfe- und Unterstützungsprozess beteiligten Menschen und Einrichtungen eine wichtige Rolle. Auch müssten vor allem Multiplikatoren in die Präventionsarbeit mit einbezogen werden, Menschen, die tagtäglich mit Kindern und Heranwachsenden arbeiten: Erzieherinnen und Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer, Betreuerinnen und Betreuer in Jugendeinrichtungen sowie Streetworkerinnen und Streetworker. Viele der in der Aktionswoche angebotenen Projekte richten sich an eben diese Multiplikatoren, die das erworbene Wissen dann auch weitergeben könnten.
Auch Angelika Frenzel von der Fachstelle für Suchtprävention der Stadt Halle (Saale) spricht die Multiplikatoren an: „Wir müssen versuchen, möglichst viele Multiplikatoren zu erreichen. Je mehr Menschen Wissen, dass es solche Phänomene gibt, desto besser.“ Eine Entstigmatisierung sei genau so wichtig wie gegenseitiges Verständnis. In einer freundlichen, vielleicht sogar familiären Atmosphäre, könnten die Probleme einfacher angesprochen werden. Frenzel sprach sich dafür aus, mehr familienorientierte Suchthilfe anzubieten. „Wenn jemand in eine Suchtberatungsstelle kommt, kümmert man sich erst einmal um das Individuum, was auch völlig legitim ist. Wenn man jedoch dann feststellt, dass eine Familie mit involviert ist, müssen wir auch die Familienmitglieder in die Therapie mit einbeziehen.“, so Frenzel.
Janine Teubner von der Schwerpunktberatungsstelle Glücksspiel Halle (Saale) sieht den ganzheitlichen Ansatz als enorm wichtig an. „Das Verschweigen der Sucht ist besonders beim Glücksspiel gang und gäbe. Bei dieser Form der Sucht sind vor allem jüngere Kinder besonders belastet, denn sie verstehen noch gar nicht, dass ein ,Spiel‘ gefährlich sein kann.“, so Teubner. Stimmungsschwankungen bei dem süchtigen Elternteil seien besonders nachteilig für Kinder und Heranwachsende, die in ihrer Entwicklung einen festen Halt und Verlässlichkeit im Verhalten der Bezugspersonen benötigten. Das Fehlen von Verlässlichkeit habe Folgen für das ganze Leben, denn sie präge Kinder und Jugendliche negativ. „Dem Süchtigen glauben wir alles, der Sucht glauben wir nichts.“, sagt Teubner und spricht damit das Thema Vertrauen an, welches in einer Therapie einen hohen Stellenwert besitzt. Erst nach einiger Zeit und zahlreichen Gesprächen öffneten sich viele Betroffene. Den Schritt von Einzelgesprächen hin zu einer Gesprächsrunde mit anderen Betroffenen schaffen bei weitem nicht alle von Teubner betreuten Menschen: „Der Übergang von einer Einzeltherapie in eine Gruppe benötigt unwahrscheinlich viel Vertrauen und Mut.“
Eric Finsterbusch, Leiter der Jugend- und Familienberatungsstelle der AWO Halle-Merseburg, greift den Punkt Vertrauen auf: „Man braucht eine gute Beziehung zu dem Menschen, den man vor sich hat, denn ohne eine gute Beziehung, zu der Vertrauen unabdingbar gehört, lässt sich niemand helfen.“ Nachdem eine Beziehung aufgebaut wurde, könne man durchaus einmal direkte Fragen stellen, was in den meisten Fällen bei den ersten Gesprächsterminen nicht möglich sei. Finsterbusch greift das eingangs genannte Problem von Schuld und Scham als Grund des Verschweigens einer Sucht auf: „Was völlig utopisch ist, ist der Gedanke, dass Kinder und Jugendliche zu uns kommen und sagen: ,Hier ich habe ein Problem!‘“ Hier müssten ganz neue Wege beschritten und Lösungen gefunden werden, um an die Betroffenen heranzukommen und diese zu ermutigen, sich einem vertrauensvollen Menschen zu öffnen.
In einem weiteren Punkt waren sich alle an dem Gespräch teilnehmenden einig: Das Thema müsse mehr in die Öffentlichkeit getragen werden um viel mehr Menschen für die Gefahren und Folgen von Sucht zu sensibilisieren. Stefan Börner, der auch selbst viele Jahre Glücksspielsüchtig war, sagt zum Schluss noch etwas, was eigentlich selbstverständlich sein sollte, es in den betroffenen Familien aber leider oft nicht ist: „Kinder tragen niemals die Schuld an einer Suchterkrankung!“




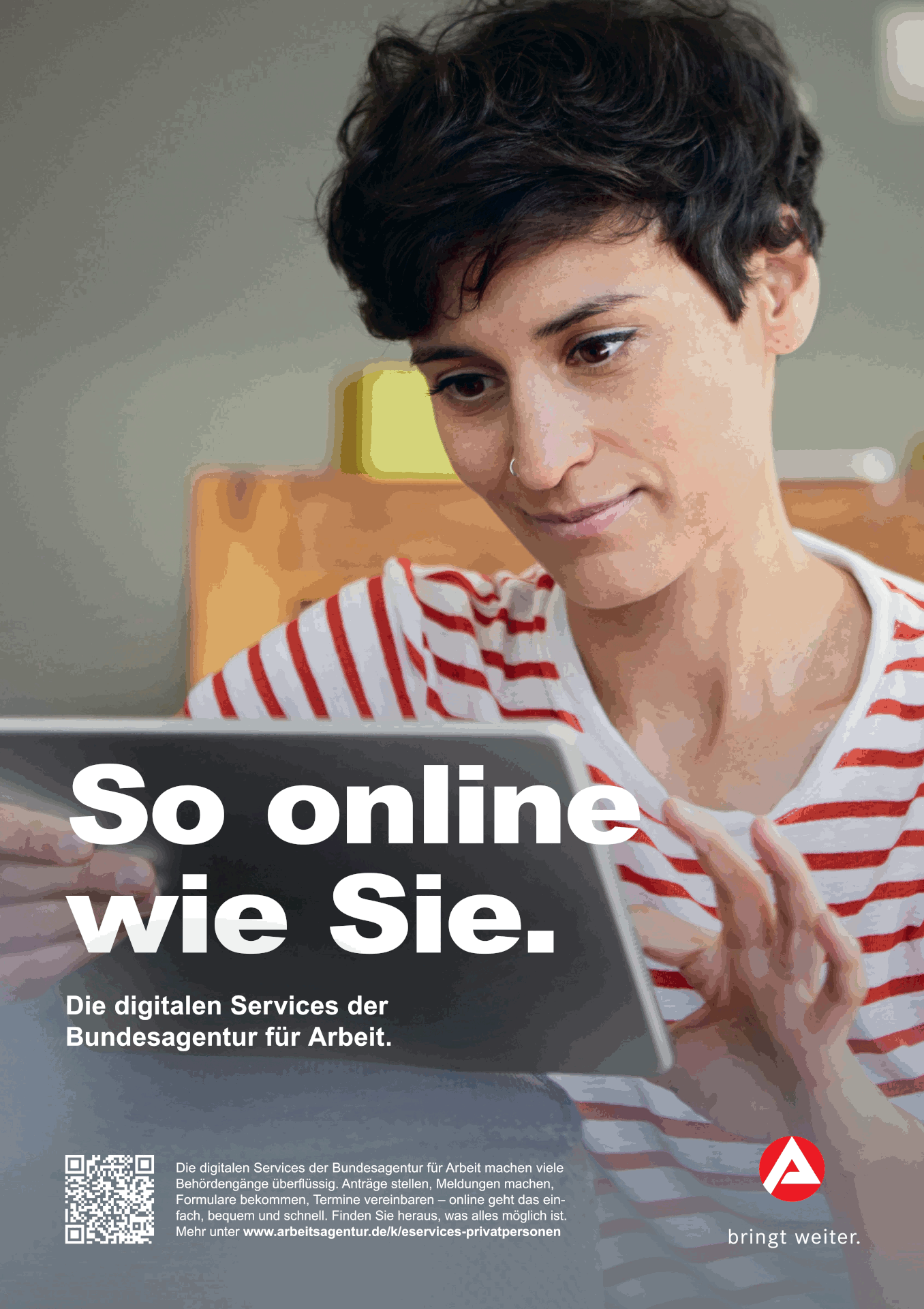







Neueste Kommentare