Quo vadis, Bühnen Halle? – Gedanken von Halles neuem Theater-Chef

Mit Stefan Rosinski haben die Halleschen Bühnen einen neuen Chef. In einer spannenden Zeit kommt er als neuer Geschäftsführer der Theater, Oper und Orchester GmbH Halle. Schließlich steht weiterhin ein Stellenabbau an, die Zuschüsse sinken. Außerdem muss er mit veränderten Bedigungen auskommen, das Wirtschaftsjahr entspricht bei der TOOH künftig nicht mehr der Spielzeit, also von Sommer bis Sommer, sondern dem Kalenderjahr. So hatte es der Aufsichtsrat beschlossen. Und so stellte Rosinski gleich einmal zu Beginn seiner Amtszeit die Frage: „Quo vadis, Bühnen Halle?“
„Stadttheater zieht seit jeher seine Stärke aus der Vielheit in der Einheit: Pluralität der Gattungen und Stile bei insgesamt trennscharfem Markenprofil, das durch Schwerpunktsetzung kommunal kenntlich und überregional identifizierbar wird: als Bühnen Halle eben“, sagte Rosinski am Mittwoch gegenüber der versammelten Presse, bevor er mit seinen Intendanten die neue Spielzeit vorstellte. „Dass das Konzept des Stadttheaters in Deutschland – mal mehr, mal weniger – auf dem politischen Prüfstand steht, ist nicht zu überhören. Häufig wird die Legitimationsdebatte als verschleierte Haushaltsdebatte geführt: das Theater sei zu teuer, die öffentlichen Haushalte zu strapaziert – bitte einsparen! Doch wir wissen, dass andere Güter der öffentlichen Hand um ein Vielfaches teurer sind und ohne Diskussion durchgewunken werden. Deshalb ist die Beschaffung von Legitimität eine wesentliche Aufgabe für die „korporative Rationalität des Überlebens“. Ein legitimes Stadttheater ist ein finanziertes Stadttheater ist ein Stadttheater mit Zukunft.“
Doch was ist überhaupt ein legitimes Stadttheater, fragte Rosinski. Deshalb führt wer weiter aus: „Die Entscheidung dazu fällt – das mag erstaunen – nicht das Publikum. In letzter Instanz entscheidet der Zuschussgeber mit seiner finanziellen Bemessung, und zwar in Bezug auf seine gesellschaftspolitischen Setzungen. Das können verschiedene Aspekte sein: soziokulturelle und bildungspolitische Zielstellungen, Image- und Renommeeaspekte und – inzwischen von zunehmender Bedeutung – Wirtschaftlichkeit, die sich in abstrakten Kennzahlen abbildet. Was sich dagegen kaum mehr als kulturpolitisches Ziel findet, ist Kunstwerkpolitik. Letzteres aber ist der vornehmliche Beweggrund für den Zuschauer, sich ins Theater zu bewegen.
Diese Tatsache darf nicht zu der irrigen Annahme verführen, als gäbe es eine Art Sprachlosigkeit zwischen Publikum und Politik. Theaterleute neigen manchmal zu einem solchen Kurzschluss; nämlich um Publikum gegen Politiker in Stellung zu bringen. Faktisch ist nicht zu übersehen, dass das Theater als Institution, das in der Mitte der bürgerlichen Gesellschaft ruht, deshalb immer weniger selbstverständlich ist, weil die bürgerliche Mitte immer weniger eine gemeinsame Sprache hat. Gesellschaft diversifiziert sich in eine Vielzahl von Milieus, und Theater verliert – ebenso wie Politik übrigens – in dieser Unübersichtlichkeit die Deutungshoheit des Einen und Ganzen.
Und nun passiert etwas sehr Interessantes, und es passiert vor allem in Sachsen-Anhalt. Was als Bewegung in der Zivilgesellschaft begann, hat sich inzwischen als Partei institutionalisiert. Die Alternative für Deutschland will über das Eine und Ganze sprechen, und sie will – tatsächlich – Kunstwerkpolitik. Sie fordert „klassische deutsche Stücke“ an den Theatern, die „zur Identifikation mit unserem Land anregen“. Kurz: Die AfD führt eine Legitimationsdebatte.
Ist das die Rettung? Oder nur ein unüberhörbares Pfeifen im Walde? Sicher ist es die Artikulation eines Mangels, der immerhin von einer signifikanten Gruppe von MitbürgerInnen empfunden wird. Um es deutlich zu sagen: eine legitime Artikulation. Gesellschaftliche Unübersichtlichkeit ist kein Phänomen, in dem man es sich ohne weiteres gemütlich einrichtet.
An dieser Stelle ist daran zu erinnern, dass die Bundesrepublik seit jeher in den Prinzipien ihrer Kunstförderung auf Ungemütlichkeit und Unübersichtlichkeit gesetzt hat. Soll heißen: Kunstwerkpolitik im Sinne der AfD wäre Verfassungsbruch. Wesentliches grundgesetzliches Prinzip ist das Neutralitätsgebot, die sogenannte Distanzpflicht des Staates gegenüber dem Freiheitsrecht der Kunst. Diese Kunstfreiheit ist nicht Selbstzweck, sondern geht zurück auf das unveräußerliche Individualrecht der Kunstfreiheit als Persönlichkeitsrecht. In Richtung AfD: Kunstförderung im Selbstverständnis der Bundesrepublik ist Gemeinwohlförderung – aber nicht, indem Politik die Inhalte von Gemeinwohl definiert, sondern indem sie zur Moderatorin der Gemeinwohlfindung wird. Das öffentliche Interesse geht auf Schutz und Förderung von Kunst, nicht auf programmatische Ziele. Staatliche Fürsorge heißt Einsatz für kulturelle Infrastruktur und Daseinsfürsorge: als Freiheitssicherung und Verteilungsgerechtigkeit.
Wenn man heute von einer „Kultur des Abendlandes“ sprechen möchte, dann wäre es dieses: eine verfassungsrechtliche Rationalität, die uns gegen jede Form des Fundamentalismus sichert. Nicht sichern kann sie uns freilich gegen unsere Ängste aus Weltverlust, wenn dieser bedeutet, dass wir angesichts der Globalisierung die Kontexte aus den Augen verlieren. Die AfD ist in gewisser Weise das Spiegelbild der Krise des Stadttheaters als Ort einer mündelsicheren Verwahrung unseres künstlerischen Erbes des Einen und Ganzen.
Aber: Stadttheater können heute ein wichtiger Ort sein, an dem die allfällige Thematisierung von Sollen und Können in Bezug auf uns als BürgerInnen und Nation, kunstmässig wird: Theater, wo das Viele im Ganzen thematisiert und ausgelotet wird; als ein Forum, das den verschiedenen Milieus Sprache gibt, ohne sich für eines vorzuentscheiden. Einen solchen Ort braucht die Stadt, wenn Stadt auch heißt: miteinander leben.
„Quo vadis, Bühnen Halle?“ – diese Frage kann die nächsten Jahre zum Synonym werden für eine Form des Stadttheaters, das Fragen und Ängste ernst nimmt, ohne sie zu zensieren; und das vor allem darin Haltung zeigt, die Freiheit der Kunst als Erbe der Kultur des Abendlandes anzuzeigen – ohne Ausschlussverfahren von welcher politischen Einfärbung auch immer. Also nicht Kunstwerkpolitik, sondern Staatsbürgerkunde: ein gesellschaftspolitisches, legitimes Ziel, das – wie ich meine – fürwahr förderungswürdig ist.“



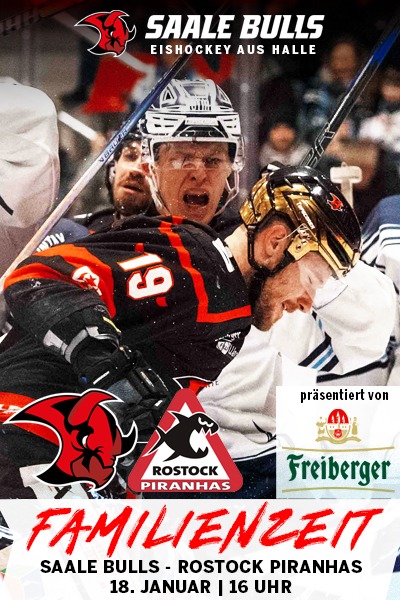





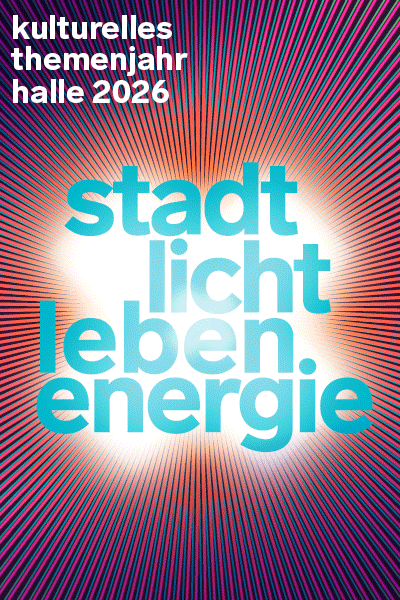
Neueste Kommentare