Studie der Universitätsmedizin Halle zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen: Harnsäure schon im Normbereich ein unterschätzter Risikofaktor – Frauen stärker betroffen
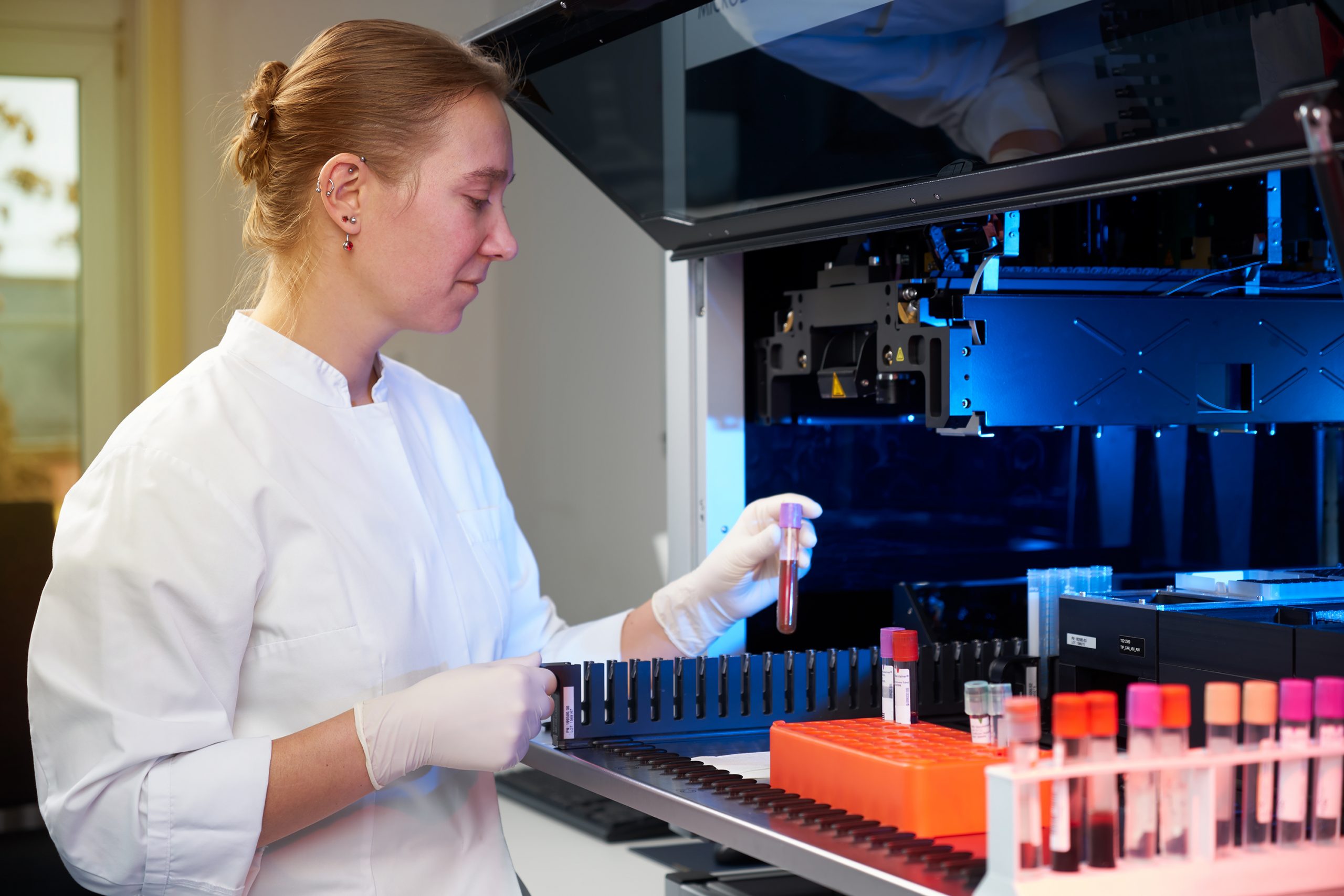
Hohe Harnsäurespiegel erhöhen das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen: Eine aktuelle Studie eines fächerübergreifenden Konsortiums der Universitätsmedizin Halle fand jedoch heraus, dass Harnsäurewerte sogar im Normbereich mit der Gefäßsteifigkeit verknüpft sind und demnach ein Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen sein können. Die Analyse basierte auf Daten und Proben von über 70.000 Personen der NAKO Gesundheitsstudie und zeigte, dass dieser Zusammenhang bei Frauen stärker ausgeprägt ist. Die im Fachjournal „BMC Medicine“ veröffentlichten Ergebnisse stellen die bestehenden Grenzwerte für „normale“ Harnsäurespiegel infrage und betonen die Bedeutung für die Gesundheitsversorgung von Frauen.
Bei Säugetieren wird Harnsäure normalerweise zu einem wasserlöslichen Stoff umgewandelt, der leicht ausgeschieden werden kann. Bei Menschen ist das zuständige Enzym im Verlauf der Evolution jedoch verloren gegangen. „Die Meisten denken bei Harnsäure an Gicht und einen dicken Zeh. Doch diese Sichtweise ist sehr einseitig, denn evolutionär gesehen bot sie einst einen physiologischen Vorteil in Zeiten der Salzknappheit. Aufgrund unseres modernen Lebensstils gelten hohe Harnsäurewerte heute als Risikofaktor für Gefäßerkrankungen, die wiederum mit Bluthochdruck und Organschäden einhergehen können“, erklärt Prof. Michael Gekle, Letztautor der Studie und Direktor des Julius-Bernstein-Instituts für Physiologie an der Universitätsmedizin Halle.
Bislang war unklar, wie genau das Risiko für Gefäßerkrankungen mit Harnsäure verknüpft ist. Dieser Frage ist ein Studienverbund aus Wissenschaftler:innen der Physiologie, Nephrologie, Biometrie, Biobank und der Arbeitsgruppe Digitale Forschungsmethoden der Universitätsmedizin Halle sowie des ansässigen NAKO-Studienzentrums nachgegangen. Die Forschenden untersuchten die Harnsäurekonzentration im Blutserum von 70.649 Teilnehmenden der NAKO Gesundheitsstudie im Alter von 19 bis 74 Jahren im Zusammenhang mit deren Gefäßsteifigkeit. Dafür wurde die sogenannte Pulswellengeschwindigkeit gemessen, also die Geschwindigkeit, mit der sich eine Druckwelle durch das Blutgefäßsystem bewegt. Je höher dieser Wert ausfällt, desto steifer sind die Gefäße.
Grenzwerte überdenken?
Neun von zehn der analysierten Personen lagen beim Harnsäurewert im Normbereich. Doch: „Bereits im physiologischen, also als unbedenklich geltenden Konzentrationsbereich, war Harnsäure positiv mit der Gefäßsteifigkeit und daher mit dem Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen verknüpft. Dieser Zusammenhang war bei Frauen stärker ausgeprägt als bei Männern“, so Gekle.
Deshalb müssten die bisherigen Harnsäure-Grenzwerte überdacht werden, so die Autor:innen. Diese liegen derzeit für Frauen bei 140-360 µmol/l und für Männer bei 180-420 µmol/l. „Als die Grenzwerte festgelegt wurden, war der Zusammenhang mit der Gefäßsteifigkeit als Risikofaktor noch nicht bekannt. Es ist möglich, dass die anzustrebenden Konzentrationsbereiche deutlich enger gefasst werden müssen als bisher angenommen“, so Prof. Oliver Thews, Erstautor der Studie und Facharzt für Physiologie an der Universitätsmedizin Halle. Laut einer Schätzung des Studienteams entspricht eine Erhöhung der Harnsäurekonzentration um 100 µmol/l einer Gefäßalterung von etwa sieben Jahren bei Frauen bzw. vier Jahren bei Männern.
Präventive Therapie im Normbereich denkbar
Es gibt weitere Geschlechterunterschiede: Frauen weisen grundsätzlich eine niedrigere Pulswellengeschwindigkeit auf. Zudem hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass eine Harnsäuretherapie bei Frauen mit hohen Werten besser wirkt als bei Männern. „Der Körper scheidet Harnsäure über die Nieren abhängig vom Geschlecht unterschiedlich aus. Eventuell hat der Anstieg der Harnsäure bei Frauen deshalb einen stärkeren Effekt. Möglicherweise lassen sich die Beobachtungen auch durch verschiedenartige molekulare Signalwege zwischen den Geschlechtern erklären“, so Thews weiter.
Die Erkenntnisse legen nahe, dass eine vorbeugende Therapie mit harnsäuresenkenden Medikamenten unter Umständen bereits bei „normalen“ Werten sinnvoll sein könnte. Insbesondere Frauen mit weiteren kardiovaskulären Risikofaktoren, wie beispielsweise Übergewicht oder Stoffwechselerkrankungen, könnten dadurch gesundheitlich profitieren.
In der Studie, in der ein großer Datensatz ausgewertet wurde, konnte außerdem ein maschinelles Lernverfahren (Random Forest) zum Einsatz kommen, um bisher unbekannte Risikofaktoren für Gefäßsteifigkeit zu identifizieren und zu gewichten. Dabei lag Harnsäure noch vor Aspekten wie Rauchen, Langzeitblutzucker und Alkoholkonsum.
Die Studie deckt einen klaren Zusammenhang zwischen Harnsäure und Gefäßsteifigkeit auf – der Beweis für eine Ursache-Wirkungs-Beziehung steht allerdings noch aus: „Wir haben jetzt eine mechanistische Erklärung dafür, warum Harnsäure als kardiovaskulärer Risikofaktor gilt. Um den kausalen Zusammenhang zu klären, sind jedoch weitere Untersuchungen nötig, beispielsweise experimentelle Studien mit primären Gefäßzellkulturen beider Geschlechter oder interventionelle Studien am Menschen“, berichtet Gekle. Das Forschungsteam arbeitet bereits an einer Folgeuntersuchung mit rund 7.000 Teilnehmenden des NAKO-Studienzentrums Halle. Dafür wurden Daten zu verschiedenen Zeitpunkten erhoben und zusätzliche Parameter einbezogen.
Originalpublikation
Thews O, […], Gekle M. Physiological serum uric acid concentrations correlate with arterial stiffness in a sex-dependent manner. BMC Med. 2025 Jul 1;23(1):356. doi: 10.1186/s12916-025-04195-8<https://doi.org/10.1186/s12916-025-04195-8>.
Foto Universitätsmedizin





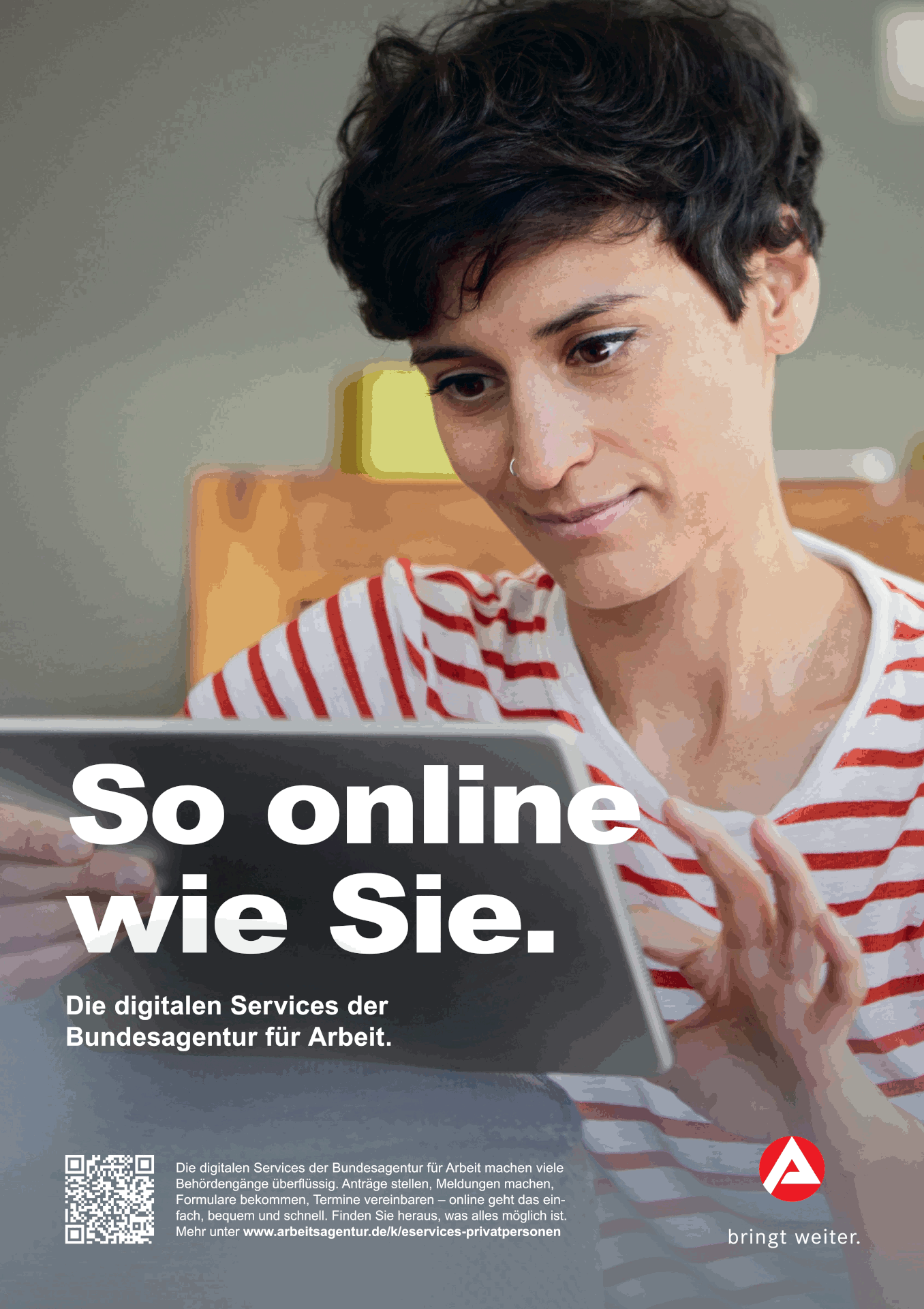





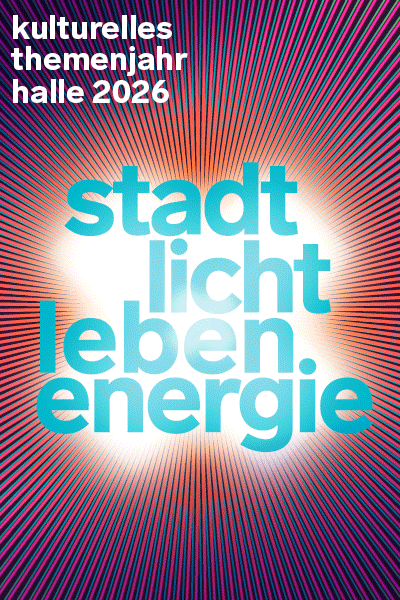
Ein gesunder Mensch bringt der Pharma- und Medizinlobby natürlich kein Geld ein, daher muss jeder per Definition zum Kranken gemacht werden. Wer sich kritisch äußert wird als Spinner, Rechter oder sonst wie denunziert.
Nö, ich sage dazu nur dumm.
Du wäschst dir auch nicht die Hände nach dem K**ken. Das merkt man deutlich.
Du kannst deine Herz-Kreislauf-Erkrankungen gerne als „gesund“ bezeichnen. Als sogenannte Selbstbestimmung liegt das gerade voll im Trend.
Keiner wird gezwungen, Medikamente zu schlucken. Aufgabe von Hausärzten ist es, mit den Patienten (auf der Basis aktueller Leitlinien) abzuwägen, ob eine Tablette eingenommen werden soll oder nicht. Jeder Patient darf „Nein“ dazu sagen.
Harnsäure wird schon lange verdächtigt, für Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit verantwortlich zu sein. Das ist auch unterm Strich plausibel- diejenigen, die einen Herzinfarkt hatten, haben meist auch einen erhöhten Harnsäurespiegel.
Je mehr man forscht, desto mehr weiß man eben und durch die Erkenntnis, dass erhöhte Harnsäure nicht nur einen dicken Zeh machen kann, kann man in Zukunft eventuell Infarkte verhindern.
Klar kann man bei jeder neuen Entdeckung „Pharma“ schreien… was ich ziemlich einfältig finde.
Am Ende entscheidet jeder für sich, ob er das Risiko durch eine Erkrankung oder das Risiko durch ein Medikament höher einschätzt.
Ein vielbesuchtes Schulungs – Thema nach 1990: „Wie schaffe ich mir einen Dauerpatienten“.
Wie sind denn die Grenzwerte in den USA oder anderen europäischen Ländern?
Was ist denn eine „aktuelle Studie“?
Die Grenzwerte sind aktuell etwa gleich. Und zum Kommentar: Dauerpatienten will man ja eigentlich vermeiden. Da hilft z.B. Prävention und Forschung, um Zusammenhänge von Erkrankungen aufzudecken (siehe oben).
Ein „vielbesuchtes Schulungsthema“?!
Bin selber seit über 20 Jahren Ärztin; sowohl im Krankenhaus und auch in Niederlassung.
Noch nie habe ich ein Schulungsangebot mit einem solchen Thema gesehen.
Daher bitte ich um Quellenangabe (wobei ich schon jetzt weiß, dass Sie diese nicht liefern können, da es ein solches Schulungsthema nicht gibt).
Immer wenn man meint, mehr Blödsinn könne man nicht lesen, kommt jemand und setzt noch einen drauf….