Psychologen untersuchen Halles Straßenbahnfahrer

Vorn in der Fahrerkabine sitzen, ab und zu mal ein paar Knöpfe drücken – nicht wenige denken so über Straßenbahnfahrer. Doch die psychischen Belastungen sind hoch. So bringen Falschparker das Fahrplangefüge ebenso durcheinander wie Unfälle oder viele einsteigende Omas mit Rollatoren. Da spielen Kinder an der Bahnsteigkante oder laufen Menschen mit Smartphone in der Hand blindlings über die Gleise. Und so ein 32-Tonnen-Triebfahrzeug ist nicht von jetzt auf gleich zu stoppen.
Im Projekt „Strab auf Trab“ untersuchen deshalb die beiden Psychologen Florian Henze und Therese Kästner vom Institut für Arbeits- Organisations- und Sozialpsychologie der Martin-Luther-Universität seit zwei Jahren die arbeitspsychologischen Belastungen der Straßenbahnfahrer und suchen nach Verbesserungsmöglichkeiten. Die Idee ist preisverdächtig, befand die Jury des Transferpreises der MLU, und zeichnete das Projekt mit 1.000 Euro aus. Stadtwerke-Arbeitsdirektor René Walther überreichte den Scheck am Dienstag. Denn es war eine kuriose Situation entstanden. Die Stadtwerke haben selbst zwei Transferpreise gesponsert und wurden wiederum für ihr eigenes Projekt von der Stadt ausgezeichnet. Das Geld soll nun dem Institut zu Verüfung stehen.
„Wir sind seit Jahren hart an dem Thema dran, warum deutschlandweit die Krankenstände bei Straßenbahnfahrern so hoch sind“, so René Walther. Das liege an der Belastungssituation. Und so war man bei der Anfrage aus dem Uni-Institut gleich aufgeschlossen. „Wir versuchen seit Jahren, die Studenten praktisch auszubilden“, sagt Institutsleiterin Renate Rau. Deshalb bestünden schon seit Jahren enge Verbindungen zum Stadtwerke-Konzern. Etliche Ideen von Studenten seien bereits umgesetzt worden. Doch das Thema Straßenbahn sei „tricky“ gewesen. Denn Straßenbahnfahrer seien bei vielen Untersuchungen außen vor gelassen gelassen worden, im Gegensatz zu Busfahrern und Lokführern.
Therese Kästner erklärte, man wollte eigentlich eine Doktorarbeit schreiben. Und um sich besser in das Thema hineinversetzen zu können, hab man im November 2014 den Führerschein für Straßenbahnen gemacht, drei Monate lang. „Die totale Konfrontation mit dem Beruf“, so Kästner. Sie sei mit viel Leidenschaft dabei gewesen, weil sie so auch viele Probleme der Fahrer am eigenen Leib zu spüren bekommen hat. Sei es der Zeitdruck oder auch das Management, wann man einmal auf Toilette geht. Nach anfänglichem Misstrauen sei auch das Eis zu den Fahrern gebrochen. „Die Fahrer haben uns ganz anders wahrgenommen“, so Kästner, die von einer „hohen Akzeptanz“ sprach. Immerhin hat sich ein Viertel aller Straßenbahnfahrer beteiligt.
Der Zwischenbericht liegt vor, sagte Uta Schmidt, bei der HAVAG für das betriebliche Gesundheitsmanagement zuständig. Dieses sei in den Gremien bereits ausgewertet worden. „Wir sind die Maßnahmen durchgegangen, was am schnellsten Wirkung zeigt.“ Und dabei ist die HAVAG bei der aktiven Pausengestaltung angekommen. Sprich: die Straßenbahnfahrer sollen in ihrer Pause mal etwasSport machen, sich bewegen. Es sei aber schwierig, einem Straßenbahnfahrer beizubringen, dass er mal sportliche Übungen machen soll. Zudem habe man alle Endstationen mit Trinkwasserspendern ausgestattet, auch seien junge Fahrer eingestellt worden. So habe man den Krankenstand senken können und habe in einem Vergleich aus 24 Verkehrsunternehmen den niedrigsten Krankenstand bei Straßenbahnfahrern. Auch habe es neue Sitze gegeben. „Die Fahrer merken, dass wir etwas tun“, so Schmidt.
Institutsleiterin Renate Rau brachte einige Belastungspunkte auf den Tisch. Es handele sich um eine isolierte Einzeltätigkeit – der Fahrer ist in seiner abgeschlossenen Kabine allein – mit einer starken Zeitbindung und einem hohen Arbeitsdruck. Das habe sie selbst bemerkt, als sie ihre Psychologen begleitet hat. Beispielhaft nannte sie eine Haltestelle, an der viele ältere Leute mit Rollatoren eingestiegen sind. „Da hat das Einsteigen drei Minuten gedauert und der Fahrer bekommt angezeigt, dass er drei Minuten im Rückstand ist“, so Rau. Und das löse schon eine Angespanntheit aus.
Eine Reihe von Baustellen gebe es, so Therese Kästner. Sei es die Gestaltung der Dienstpläne oder der Fahrpläne. Doch das aktuelle Projekt sende das Signal an die Fahrer, dass etwas passiere. Doch so einfach die Dienstpläne umstellen, das geht auch nicht, so Stadtwerke-Arbeitsdirektor René Walther, der auch auf ökonomische Punkte verweist. Die Studie sei eine gute Grundlage, doch alles in allem sei es ein sehr komplexes System. Uta Schmidt erläutert aber, man habe zum Ziel, die Belastungen zu senken. „Am Thema Dienstpläne sind wir mit dem Betriebsrat schon eine ganze Weile dran.“ Allerdings müssen dabei auch rechtliche Hürden beachtet werden. So schreibt das Arbeitsschutzgesetz vor, dass innerhalb der ersten vier Stunden eine Pause gewährt werden müsse. Viele Fahrer würden sich diese aber gern später wünschen, doch man könne nicht einfach das Gesetz außer Kraft setzen.
Die Fahrer der HAVAG seien überwiegend zufrieden mit ihrem Job. „Das Fahren macht Spaß“, so Florian Henze. Doch es gebe eben die Momente akuter Belastungssituationen wie Falschparker in der Geiststraße oder unaufmerksame Personen mit Smartphone. Als Büromensch habe er es zunächst einmal als Willkommene Abwechslung empfunden, nicht so viel kommunizieren zu müssen. Doch auf Dauer sei dies anstrengend, nur im Störungsfall mit Kollegen kommuzieren zu können. Zusätzlichen Druck baue das persönliche Ziel auf, pünktlich zu sein, was durch äußere Einflüsse ins Wanken gerät.
Therese Kästner brachte den Pausencoach ins Spiel, den es schon einmal bei den Stadtwerken gab. Dieser könnte an großen Endstationen eingesetzt werden und Fahrer zu Bewegungen animieren. Henze und Kästner sind weiterhin einmal in der Woche als Fahrer auf den halleschen Schienen unterwegs. Dadurch brauchen sie nicht nur Umfragen auswerten, sondern können auch eigene Erlebnisse einfließen lassen. Deshalb weiß Therese Kästner auch, wie wichtig es ist, die Fahrer in ihren Pausen „zu Bewegen“. So habe sie in der vergangenen Woche die neue Linie 7 gefahren, die Baustellenbedingt einige Änderungen erfahren hat. Fünf Minuten Wendezeit habe sie am Gimritzer Damm, die durch Verspätungen ins Wanken geraten. „Mal schnell auf Toilette gehen und aufs Handy gucken“, das wars.






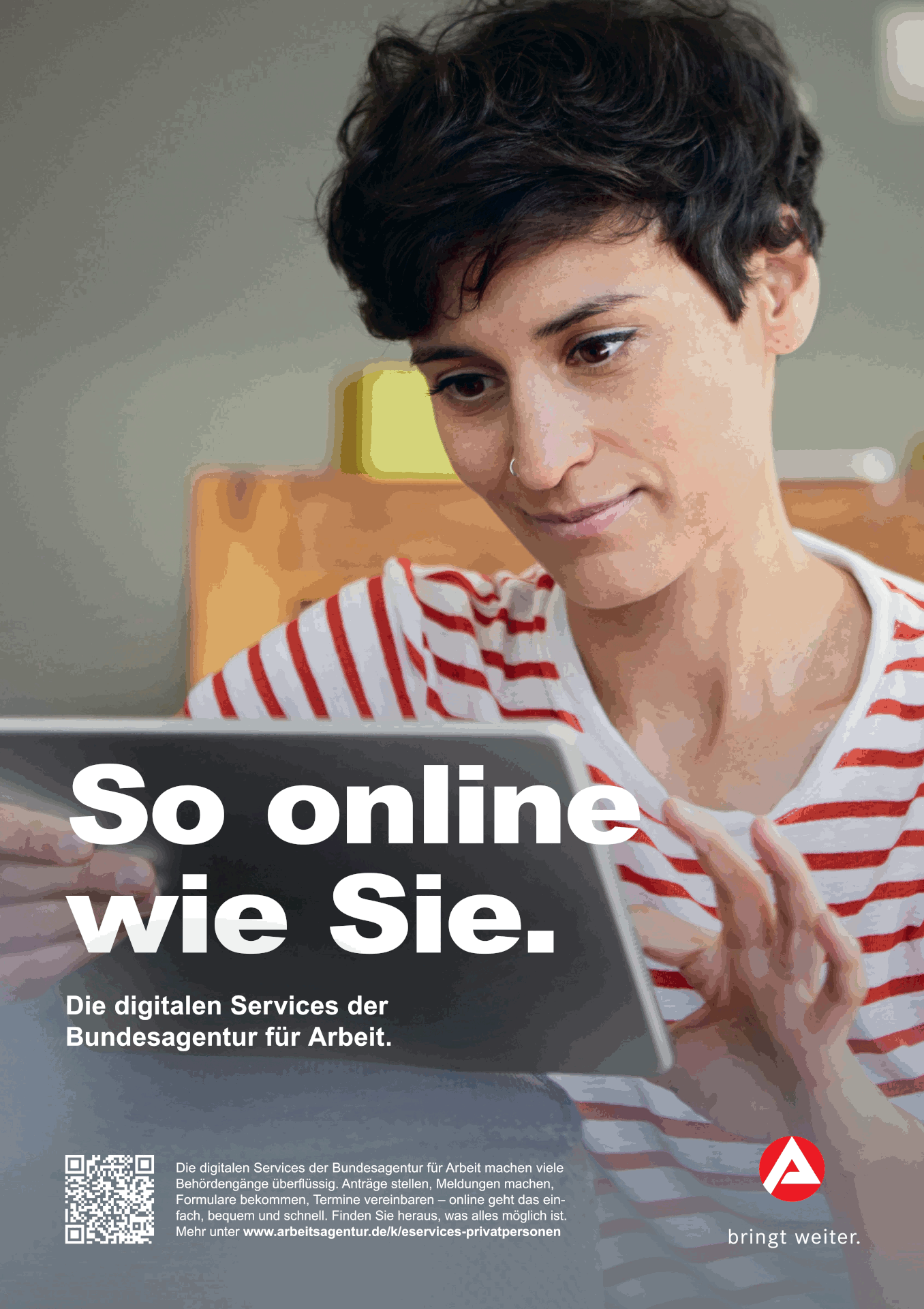





Neueste Kommentare