Ausstellung „graduiert ≈ präsentiert“ im Vokspark – Zehn künstlerische Positionen zwischen persönlicher Geschichte, Forschung und gesellschaftlicher Reflexion

Am Dienstag wurde in der Galerie im Volkspark die Ausstellung „graduiert ≈ präsentiert“ der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle (BURG) eröffnet. Die Präsentation, die bis zum 9. November 2025 zu sehen ist, bietet einen facettenreichen Einblick in neue Arbeiten von zehn Künstlerinnen und Designerinnen, die 2024 und 2025 ein Stipendium der Graduiertenförderung des Landes Sachsen-Anhalt erhielten.
Förderung künstlerischer Entwicklung
Mit dem Graduiertenprogramm fördert das Land Sachsen-Anhalt gezielt den künstlerischen und wissenschaftlichen Nachwuchs. Die Hochschule BURG begleitet diese Förderung seit Jahren mit wachsender Intensität. Die Abschlussausstellung „graduiert ≈ präsentiert“ bildet den sichtbaren Abschluss dieses Prozesses und steht exemplarisch für die umfassende Absolvent*innenförderung an der BURG, die nicht nur finanziellen Freiraum schafft, sondern auch künstlerische Entwicklung in engem Austausch mit Theorie, Forschung und Öffentlichkeit ermöglicht.
Die zehn ausstellenden Künstlerinnen und Designerinnen sind:
Simon Baumgart, José Madrigal Despaigne, Michal Fuchs, Binha Haase, Vanessa Henning, Philipp Keidler, Youjeong Kim, Younghyun Min, Bettina Nagler und Carla Westphälinger. Ihre Arbeiten entstanden in einem Zeitraum intensiver Auseinandersetzung mit persönlichen, politischen und gesellschaftlichen Themen – und zeigen die Vielfalt künstlerischer Strategien, von Performance über Soundinstallationen bis zu Zeichnung, Malerei, Theoriearbeit und Publikation. Jeden Sonntag um 15 Uhr Studierende der kunstpädagogischen Studiengänge sowie des Masterstudiengangs Kunstwissenschaften Führungen durch die Ausstellung an.
Simon Baumgart – Geschichte als Gefühl und Erbe
In seiner Installation „365,25 Gefühle meines Urgroßvaters“ setzt sich Simon Baumgart mit der Geschichte seiner Familie und deren Verflechtung mit kollektiven Erinnerungen auseinander. Ausgangspunkt ist die Kirche von Pretzschendorf im Erzgebirge, wo seine Familie lebt. „Sie hat mich interessiert als Gehäuse der Gemeinschaft“, sagt Baumgart – ein Ort, der früher Zentrum des Gemeindelebens war, heute jedoch oft leer steht. Das Werk verknüpft die Geschichte seines Urgroßvaters Willy K. – NSDAP-Ortsgruppenleiter und später LPG-Vorsitzender – mit den unausgesprochenen Emotionen einer ganzen Epoche. Wiederholung wird zum Leitmotiv: Baumgart fragt, ob sie zur Befreiung oder zur Falle werden kann.
José Madrigal Despaigne – Migration, Sprache, Körper
José Madrigal Despaigne verarbeitet in seiner Arbeit „Echar de Mas“ eigene Migrationserfahrungen. Seine künstlerische Praxis verbindet Installation, Performance und poetisches Schreiben. In seiner typografischen Arbeit „Untitled (human)“ visualisiert er das Wort „Mensch“ in 99 Sprachen – darunter „Humano“, „Taotao“, „Winik“, „Inuk“, „Wügüri“, „Mmadu“, „Mutum“. Diese sprachliche Vielfalt ist Ausdruck einer universellen, aber zugleich fragmentierten Identität.
Besonders eindrucksvoll ist eine Performance mit einem Kleidungsstück, auf das er über Jahre gesammelte Steine genäht hat. Die Kleidung wird dadurch immer schwerer – eine physische Metapher für die emotionale Last von Flucht, Entwurzelung und kulturellem Transfer.
Michal Fuchs – Zeichnung als Selbstheilung
Statt einem geplanten Forschungsvorhaben nachzugehen, wurde Michal Fuchs durch den 7. Oktober 2023 in einen tiefgreifenden persönlichen Prozess geworfen. Sie begann, tausende kleine Linien zu zeichnen – Frauenfiguren, Rauchfahnen – als Akt der Selbstheilung. Die Motive veränderten im Verlauf ihre Bedeutung und entwickelten sich zu symbolischen Formen. In einer zweiten Werkgruppe mit dem Titel „Hora“ greift Fuchs den Kreistanz als kulturelles und spirituelles Motiv auf – als Ausdruck von Gemeinschaft, landwirtschaftlichen Zyklen, aber auch nationalen Erzählungen, die durch Migration neu gelesen werden.
Vanessa Henning – Ekstase, Kontrolle und biografische Spurensuche
Für ihre Arbeit ließ sich Vanessa Henning von einer Produktion des neuen theater Halle zu den Bakchai, ekstatischen Anhänger*innen des Dionysos, inspirieren – ein Thema, das für sie auch biografische Relevanz hat. Ihre Eltern waren Teil der Kommune des Künstlers Otto Mühl. Henning führte Interviews mit ehemaligen Mitgliedern, um zu untersuchen, wie utopische Ideale in Zwang und Kontrolle umschlagen können.
Im Zentrum ihrer Installation „AT BAKCHAI“ steht ein Mischpult, das auch im Theaterstück eine zentrale Rolle spielte. „Dieses Pult war Dreh- und Angelpunkt der Produktion“, erklärt Henning. Besucher*innen können über Kopfhörer Tonspuren aus der Inszenierung hören, selbst experimentieren, das Setup verändern. Ein Kontaktmikrofon, das auf dem Parkettboden angebracht ist, sampelt Schritte und Tritte – jede Bewegung wird Teil eines neuen, kollektiven Klangkörpers. Ein weiterer Bestandteil: Interviews mit sechs Befragten zum Thema Gefühle.
Philipp Keidler – Klanglandschaften zwischen Tiefe und Oberfläche
Philipp Keidler verwebt Landschaft und Erinnerung. In seiner Arbeit begegnen sich zwei Orte: der vom Kaliabbau geprägte Raum um das Kaliwerk Teutschenthal und seine Heimat in den Allgäuer Alpen. Zwei Soundobjekte und Salzdrucke sind im Rahmen der Förderung entstanden. Im Objekt „Aus der Tiefe in den Raum“ verschmelzen Schachtgeräusche, Naturklänge und Alphornmusik zu einem eigens komponierten Klangstück. Es illustriert seine These, dass Natur nicht nur durch Pflanzen und Tiere, sondern auch durch Maschinen und menschliche Tätigkeit entsteht.
Youjeong Kim – Tore als Schwellen zwischen Vergangenheit und Gegenwart
Drei großformatige Gemälde zeigt Youjeong Kim unter dem Titel „Das Goldene Tor“. Sie beschäftigt sich mit der Symbolik von Toren – inspiriert durch das kunstvolle Tor ihres Elternhauses in Nonsan, Südkorea. Die Bilder thematisieren Abschied, Verlust und Heimkehr. Das verwendete Gold reflektiert äußeren Glanz, verbirgt aber oft ein dunkles Inneres. Bronzene, plastisch verzierte Schlüssel, die an den Bildern angebracht sind, verweisen auf Zugang, Erinnerung – und auf die Möglichkeit eines „Zuhause“, das vielleicht nicht mehr existiert.
Younghyun Min – Grenzerfahrungen, Krieg, Erinnerung
Sein Projekt „Identität – Cheorwon Calling“ basiert auf eigenen Erfahrungen als Grenzsoldat in Südkorea. Der Überfall Russlands auf die Ukraine im Jahr 2022 reaktivierte diese Erlebnisse, die er nun mit der deutsch-deutschen Geschichte verknüpft. Nach seinem Umzug nach Berlin begann er, Fundstücke entlang der Berliner Mauer zu sammeln und mit persönlichen Motiven zu verbinden. Entstanden sind zehn großformatige Collagen, die politische Geschichte, nationale Identität und persönliche Erinnerung in Beziehung setzen.
Bettina Nagler – Feministische Theorie und architektonisches Rauschen
Ausgangspunkt der Arbeit von Bettina Nagler war die Bauwelt-Sonderausgabe „Frauen in der Architektur – Frauenarchitektur?“ aus dem Jahr 1979. Die dort versammelten feministischen Positionen sind für sie der Anlass, über heutige Fragen zu Arbeitsweisen, Autor*innenschaft, Vereinbarkeit von Leben und Beruf nachzudenken. Im Verlauf ihrer Forschung entwickelte sie das Konzept des „Pink Noise“, entlehnt aus der Akustik: ein subversives Rauschen, das den Nachhall weiblicher Stimmen hörbar macht – auch jenseits der offiziellen Narrative.
Carla Westphälinger – Fehlerkultur und visuelle Kommunikation
Carla Westphälinger befasst sich mit dem Thema Scheitern. In ihrem selbst entwickelten, geschriebenen und illustrierten Buch „Bitte versuchen Sie es später nochmal“ beschäftigt sie sich mit Fehlerkultur in Gesellschaft und Alltag. Gespräche mit vielen Menschen bilden die Grundlage für verschiedene Perspektiven auf Scham, Schuld und Lernprozesse. Typografie und Erzählstruktur reflektieren den Prozess des Verstehens – voller Umwege, Brüche und Entwicklung. In der Ausstellung lädt eine interaktive Pinnwand Besucher*innen, ihre Erfahrungen zu teilen und eine offenere Haltung zum Scheitern einzunehmen.

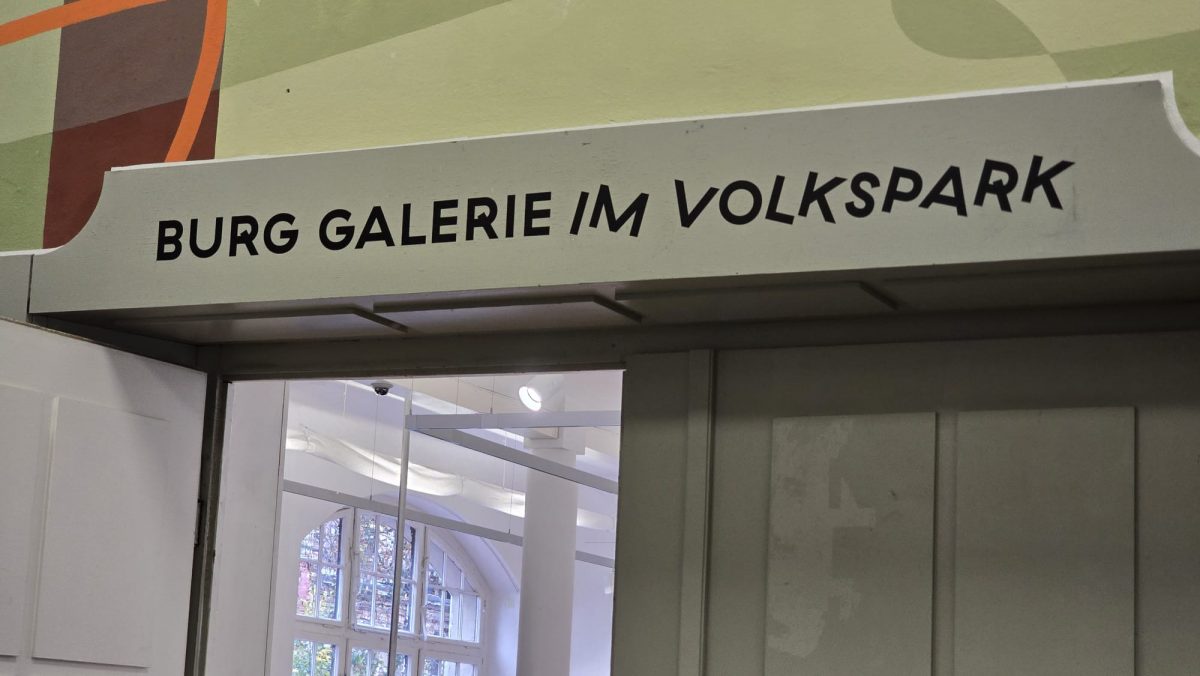























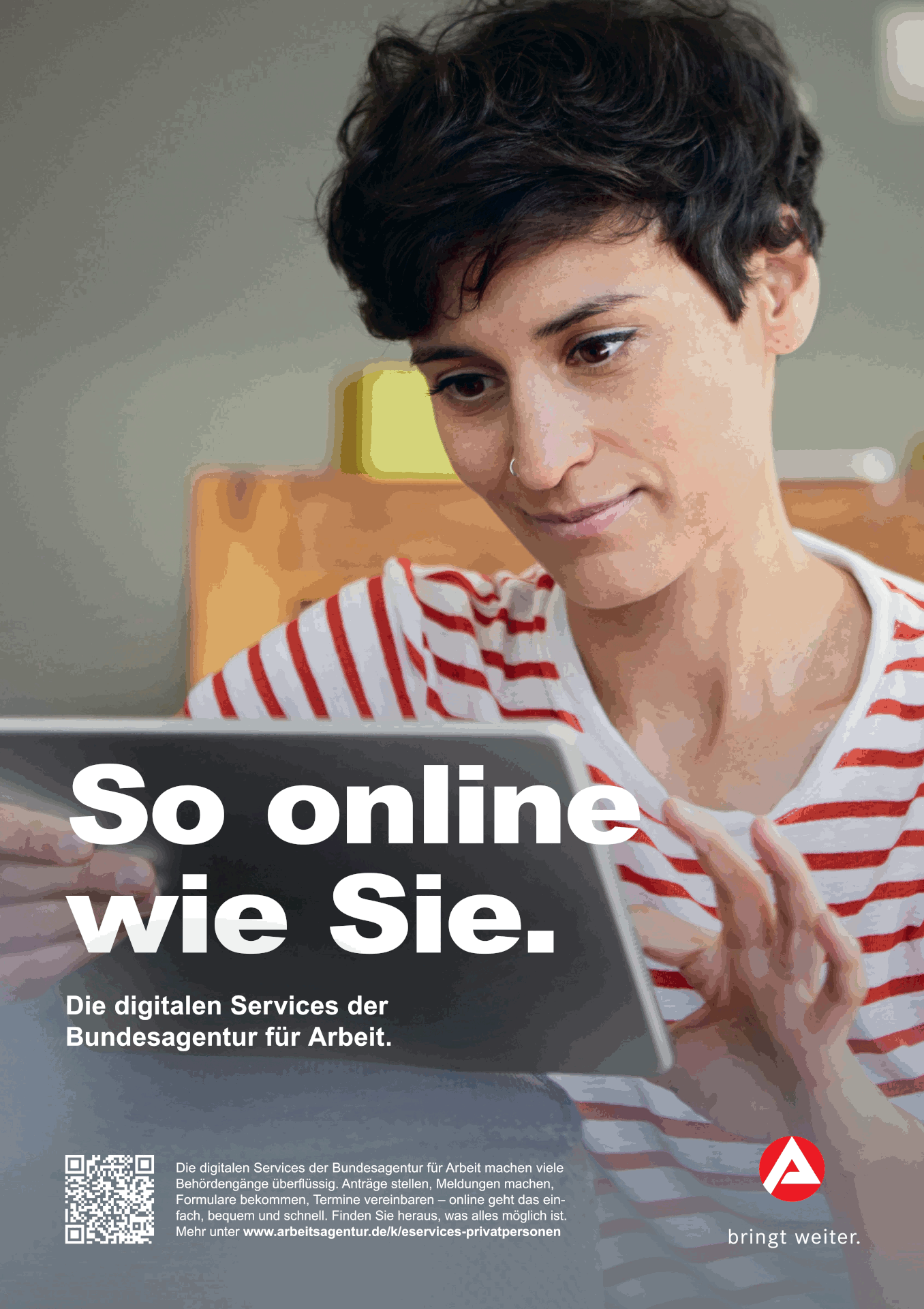

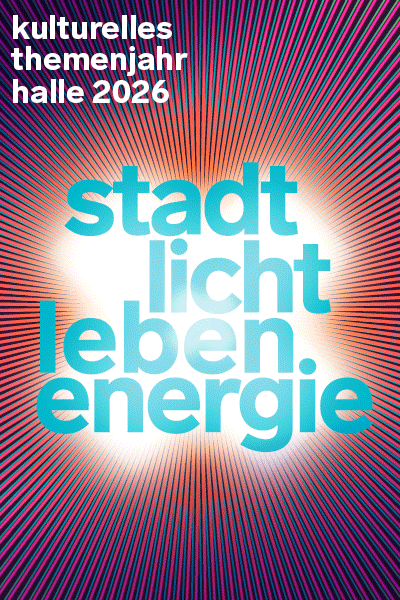
Das Bild zeigt auf deprimierende Weise die Einfallslosigkeit dieser Nichtkünstler, deren Basteleien vor allem in D für Kunst erklärt werden.
…und du legst fest was „Kunst“ sein darf?
Haben Sie sich die Sachen denn in Ruhe einmal angesehen und sich auf Sie eingelassen, bzw. werden Sie das noch machen? Da steckt ja viel Arbeit und Mühe drin.