Sprachentwicklungsprojekte in Kooperation mit der Martin-Luther-Universität starten in den Franckeschen Stiftungen

Sprachentwicklungsstörungen gehören zu den häufigsten Entwicklungsstörungen im Kindesalter. Dennoch sind sie innerhalb der Bevölkerung nach wie vor relativ unbekannt und bleiben teils unentdeckt. Langanhaltende, massive sprachliche Schwierigkeiten können jedoch die schulische und berufliche Entwicklung sowie die gesellschaftliche Teilhabe von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen deutlich beeinflussen.
In den Kindereinrichtungen der Franckeschen Stiftungen starten deshalb im Oktober 2022 zwei neue Unterstützungsprojekte in Kooperation mit dem Arbeitsbereich Pädagogik, Prävention und Intervention bei Sprach- und Kommunikationsbeeinträchtigungen (MLU):
»KommSelbst«, unterstützt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung BMBF, nimmt das sprachlich- kommunikative Selbstkonzept von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund in den Blick.
Das Besondere am Projekt ist, dass es nicht wie sonst üblich den Wortschatz oder die Grammatik der mehrsprachigen Kinder und Jugendlichen in den Blick nimmt, sondern das sprachliche Selbstkonzept. Dabei interessiert, wie sich die Kinder und Jugendlichen in Kommunikations- und Interaktionssituationen, also in Gesprächen in Kita, Schule und Umfeld fühlen. Gibt es Situationen, in denen sie gut und gern kommunizieren? Gibt es Situationen, die sie meiden und in denen sie nicht sprechen? »Gerade im Übergang von der Kita in die Schule oder von der Grundschule in die Sekundarschule ändert sich viel. Die Kinder müssen mit neuen Bezugspersonen (Erzieher, Lehrer), mit neuen Klassenkameraden und in unbekannten Gebäuden und Räumen kommunizieren. Wir wollen verstehen, wie wir sie bei dieser Aufgabe unterstützen können und eine entsprechende Förderung entwickeln.«, erläutern die projektverantwortlichen WissenschaftlerInnen Prof. Dr. Stephan Sallat und Ellen Saal.
In »Beat my Speech« lernen Vorschulkinder einmal in der Woche mit ihrem Mund Schlagzeuggeräusche nachzumachen. Beatvoxing kommt ursprünglich aus der HipHop-Bewegung. Prof. Dr. Stephan Sallat und Ellen Saal sehen hier große Potentiale für die Sprach- und Ausspracheförderung von Kindern: »Das Beatvoxing macht den Kindern unheimlich viel Spaß und sie merken gar nicht, wie intensiv sie dabei an ihrer Stimme und der Sprache arbeiten. Wir haben dieses Vorgehen auch schon an der Sprachheilschule Halle erprobt und arbeiten nun mit jüngeren Kindern in der Kita Amos Comenius der Stiftungen«. Das Projekt wird auch von der Kroschke Kinderstiftung finanziell unterstützt.
Zwischen den Franckeschen Stiftungen mit ihren pädagogischen und frühpädagogischen Einrichtungen und dem Arbeitsbereich Pädagogik, Prävention und Intervention bei Sprach- und Kommunikationsbeeinträchtigungen der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg hat es in den letzten Jahren mehrere gemeinsame Projekte mit dem Ziel der Sprach- und Kommunikationsförderung gegeben. So wurden beispielsweise Kinder musiktherapeutisch in Kleingruppen gefördert und in Abschlussarbeiten von Studierenden Themen bearbeitet. Seit einem Jahr gibt es zudem eine Kooperation im vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Projekt SprachNetz – Digtiales Netzwerk Sprache. Die Franckeschen Stiftungen sind hier Praxispartner. SprachNetz organisiert unter anderem eine digitale Sprechstunde zum Thema Sprachentwicklung, Sprachentwicklungsstörung und Förderung.
Internationaler Tag der Sprachentwicklungsstörung am 14. Oktober 2022
Um das Bewusstsein für den kindlichen Spracherwerb und seine Störungen in der breiten Öffentlichkeit zu stärken, machen weltweit am 14. Oktober engagierte TherapeutInnen, ÄrztInnen, Lehrkräfte, ErzieherInnen, WissenschaftlerInnen, Betroffene und ihre Familien sowie weitere UnterstützterInnen mit verschiedensten Aktionen auf das Thema aufmerksam.







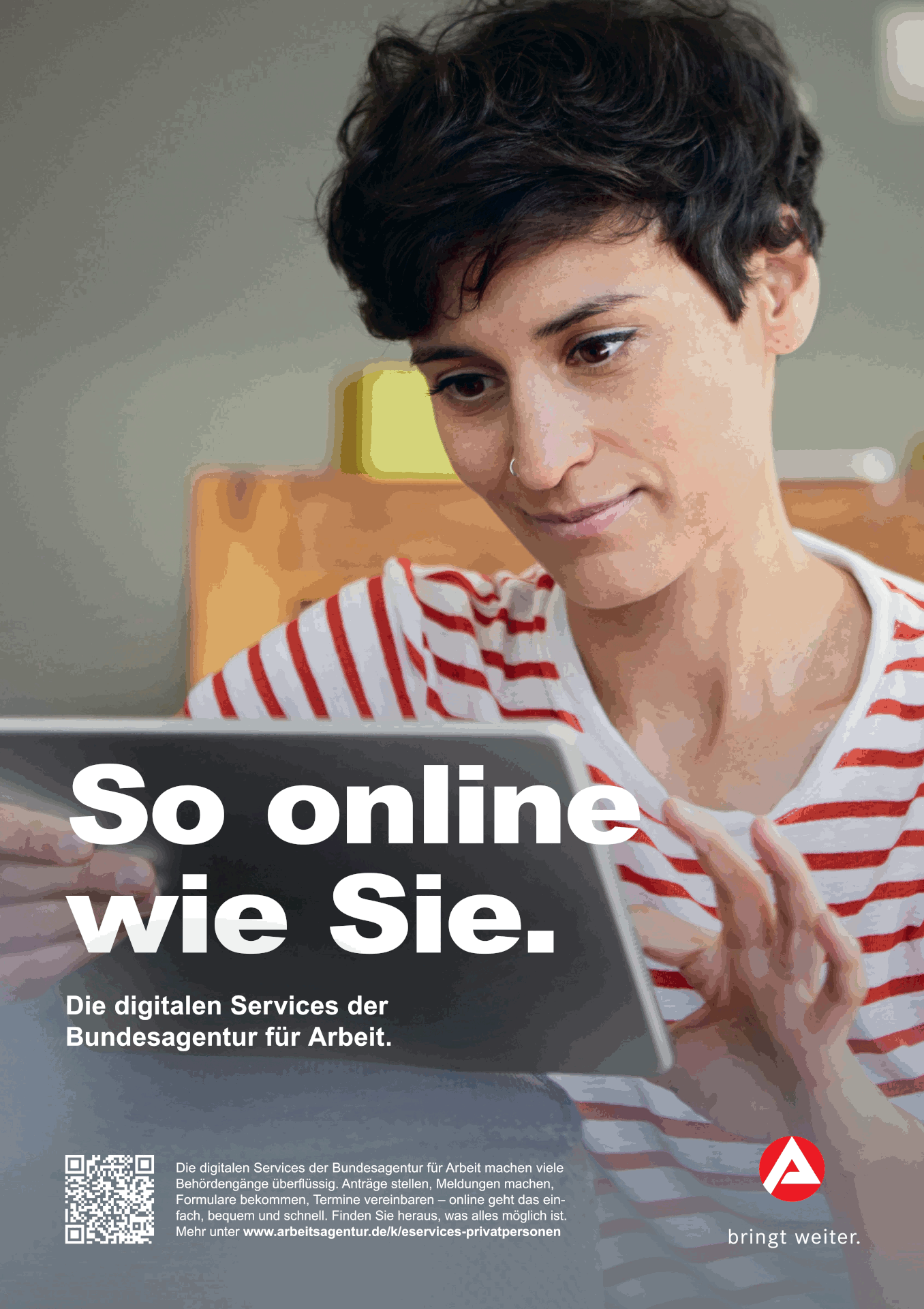



Das bleibt einem die Sprache weg
Versteh ich, hätte dir vielleicht auch geholfen. 😉
Sprachentwicklungsstörungen gehören zu den häufigsten Entwicklungsstörungen im Kindesalter.
Später im Leben wird das sogar noch gepflegt, indem die Gendersprache verpflichtend durchgesetzt werden soll, gegen den Willen der Bevölkerung.
Es gibt sogar Lehrstühle dafür. LOLOL
Steff,
Gendersprache als Wortschatz und grammatikalische Frage hat nichts mit diesen Beitrag zu tuhen. Es geht in dem Projekt unteranderem um Kommunikationsbereitschaft und Austausch unter Kindern. Gerade mehrsprachigen.
Erst lesen, dann schreiben Steff.
Dein Beitrag hat jedenfalls nichts mit Deutsch zu tun.
Gendersprache hat sehr wohl etwas damit zu tun.
Gendern ist sinnlos, verhunzt die Sprache und ist politisch angeordnet.
Es besteht keine Bereitschaft dazu bei der Mehrheit der Bevölkerung.
Dazu zählen auch Kinder, die durch dieses Schulsystem schon genug verraten werden.
Verraten durch ideologische Bildung, mangelndes Niveau, Stundenausfälle in ungeheurem Ausmaß, Coronapolitik ….
Sehr gut. Wer gelernt hat, sich zu artikulieren, der wird es später im Leben leichter haben. Allerdings ist es unerlässlich auch das Zuhören zu üben, denn nur beide Fähigkeiten in Kombination machen Dialog – und Diskussionsfähigkeit aus. Meistens werden Kinder von ihren Eltern oder anderen Erwachsenen entweder gar nicht oder zuviel zu Wort kommen gelassen. Kinder, die permanent mit Bestrafung rechnen müssen, werden sich wahrscheinlich zoegerlicher auf dem Gebiet der Sprachfähigkeit und auch allgemein entwickeln als Kinder in einem milderen Umfeld. Kinder, mit denen niemand spricht, weil sie vor dem Fernseher abgeparkt werden, wird es da nicht besser gehen. Kinder, die am Vorbild gelernt haben, das Probleme eher mit Gewalt als Worten gelöst werden, werden gar keine Notwendigkeit eines differenziertere Spracherwerbs sehen.
Dafür ist „Beatvoxing“ doch genau die richtige Lösung.
Na ja. Beatvoxing finde ich albern, da es im Leben nicht wirklich weiterhilft. Vielleicht hilft es ja Kindern mit verknoteten Stimmbändern diese wieder zu entknoten.
Verknotete Politikergehirne sind eher das Problem derzeit…
„Sprachentwicklungsstörungen gehören zu den häufigsten Entwicklungsstörungen im Kindesalter.“
Zweieinhalb Jahre Maskenball bleiben eben nicht ohne Folgen.