Vom Fraunhofer IWMS in Halle (Saale) entwickelt: Neue Generation von FFP2-Masken vereint Schutz, Komfort und Nachhaltigkeit

Atemschutzmasken sind aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Ob im Gesundheitswesen, im industriellen Arbeitsschutz oder während globaler Pandemien – sie schützen vor Schadstoffen und Krankheitserregern. Manche Modelle zeigen in der Praxis jedoch Schwächen: Sie sind unbequem, passen nicht auf jedes Gesicht und belasten als Abfall die Umwelt. Im jetzt abgeschlossenen Forschungsprojekt »BestComfort« hat das Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWS in Halle (Saale) gemeinsam mit Partnern aus der Industrie eine innovative FFP2-Maske entwickelt, die ergonomisch optimiert ist, höchste Schutzwirkung bietet und zugleich nachhaltig recycelt werden kann.
Während FFP2-Masken zuverlässig Partikel filtern, gelingt es vielen handelsüblichen Modellen nicht, sich an die Vielfalt menschlicher Gesichtsformen optimal anzupassen. Dadurch entstehen Leckagen, die die Schutzwirkung mindern. Zudem bestehen die meisten Masken aus mehreren verschiedenen Materialien, was eine sortenreine Wiederverwertung nahezu unmöglich macht. Das Projekt »BestComfort« setzt hier an und kombiniert ergonomische Gestaltung mit materialwissenschaftlicher Innovation und nachhaltigem Produktdesign.
Im Projektzeitraum von zwei Jahren wurden auf Grundlage umfangreicher Kopf- und Gesichtsanalysen neuartige Maskenkomponenten entwickelt. Im Fokus standen die Nasen- und Ohrenbügel, die in unterschiedlichen Varianten konstruiert und getestet wurden. Diese Bügel wurden so gestaltet, dass sie sich individuell an verschiedene Gesichtsgeometrien anpassen, Druckstellen reduzieren und den Dichtsitz deutlich verbessern, also neben dem Tragekomfort auch die Filterwirkung steigern. Parallel dazu entwickelte das Fraunhofer-Team zusammen mit der A+M GmbH und der PORTEC GmbH ein sogenanntes Monomaterial-Konzept. Sämtliche Maskenkomponenten bestehen aus polymerbasierten Werkstoffen wie Polypropylen oder Polypropylen-basierten Materialien. Damit lassen sich die Masken nach Gebrauch vollständig und sortenrein recyceln, was einen erheblichen Beitrag zur Nachhaltigkeit leistet.
Um die neuen Konzepte praxisnah zu erproben, kamen moderne Fertigungsverfahren wie 3D-Druck, Vakuumguss und Spritzguss zum Einsatz. Diese Methoden ermöglichten es, verschiedene Designs schnell umzusetzen und funktionsfähige Prototypen herzustellen. Anschließend wurden die Maskendemonstratoren in umfangreichen Probandenstudien getestet. Dabei wurden sowohl Alltagssituationen als auch körperliche Belastungen simuliert, zusätzlich wurden physiologische Untersuchungen zur Wärme- und Feuchtigkeitsentwicklung während des Tragens durchgeführt.
Ein zentrales Element der Forschungsarbeit am Fraunhofer IMWS war die Entwicklung eines automatisierten Messplatzes zur Bewertung der Passform und Dichtigkeit der Masken. Der Prüfstand nach DIN EN 149:2001 ermöglicht es, objektive Messdaten zur Maskenleistung zu erheben, ohne in jedem Fall auf aufwendige und zeitintensive Probandenstudien angewiesen zu sein. »Das ist ein großer Vorteil. Diese Automatisierung trägt wesentlich zur Effizienzsteigerung in der Produktentwicklung bei und erlaubt eine reproduzierbare, standardisierte Bewertung unter praxisnahen Bedingungen«, sagt Annika Thormann, Projektleiterin am Fraunhofer IMWS. Darüber hinaus ermöglicht die materialwissenschaftliche Expertise am Fraunhofer IMWS eine tiefgehende Charakterisierung der verwendeten Materialien bis auf die Mikrostruktur-Ebene. Mithilfe moderner Analysetechniken wurden die mechanischen, thermischen und mikrostrukturellen Eigenschaften der Maskenkomponenten untersucht. »Im Projekt ist es uns zusammen mit den Partnern gelungen, eine Maske zu entwickeln, die Schutz, Komfort und Nachhaltigkeit gleichermaßen vereint. Damit zeigen wir, dass Hightech-Materialforschung und praxisnahe Entwicklung Hand in Hand gehen können«, ergänzt Thormann.
Die Projektergebnisse wurden bereits auf internationalen Fachmessen wie der formnext in Frankfurt und der rapidtec in Erfurt vorgestellt und stießen dort auf großes Interesse bei Fachpublikum und Industrie. Erste Gespräche mit potenziellen Partnern eröffnen zudem vielversprechende Perspektiven für die Weiterentwicklung und Markteinführung.
Foto: Fraunhofer IWMS











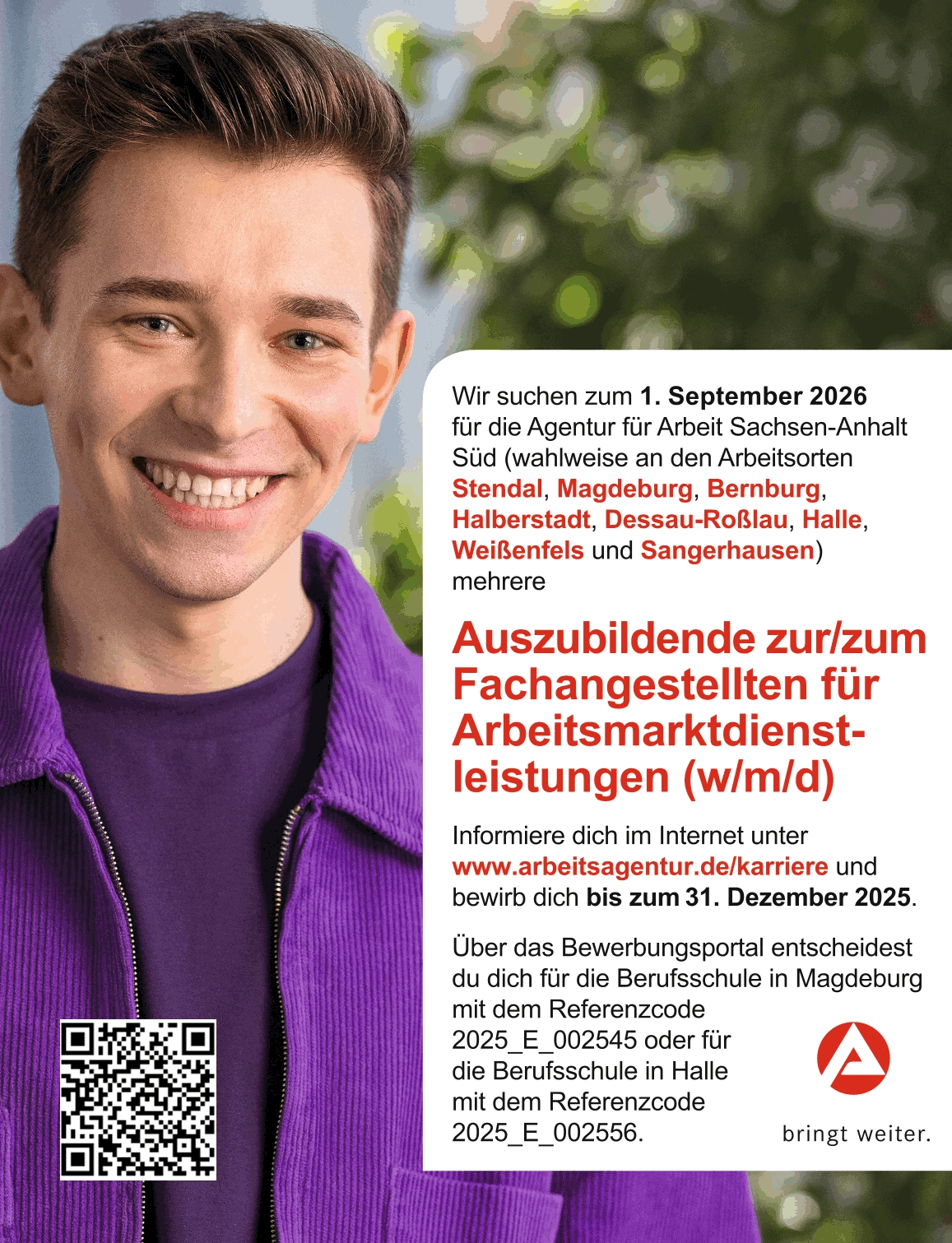


Na, wenn das mal nicht Bock auf die nächste Pandemie macht. Der Tragekomfort der alten Masken war echt unterirdisch.
Woher kommt denn immer nur der Aberglaube, dass diese Dinger „vor Krankheitserregern“ schützen würden?
Weil man diesen Unsinn während Corona immer wieder behauptet hat? Das sind Staubschutzmasken. Mit Krankheitserregern hat das null zu tun und das, was der Arzt während der OP vor dem Mund hat ist, salopp gesagt, dazu da, dass der Sabber vom Doc nicht in die offene OP Wunde tropft. Mehr nicht.
Und was wäre so schlimm daran, wenn der Sabber vom Doc in die offene OP Wunde tropft? Na?
(NB: Im OP wird übrigens nur selten FFP2 getragen. Aber wir machen erstmal Grundlagen. 😉)
Der Poster über dir hat ja zumindest Recht, vom „Sabber“ abgesehen gibt es nunmal fast keinen Schutz gegen Mikroben….der Großteil marschiert da einfach durch.
Also Tröpfchen.
Jetzt müsste man nur noch herausfinden, ob Partikelfilter Tröpfchen aufhalten können.
Natürlich ist den Masken egal, ob die Partikel, die gefiltert werden, Staub, Sabber oder Viren sind. Solange die Partikel groß genug sind, um aufgehalten zu werden, werden sie rausgefiltert.
Die Masken waren eine der effektivsten Maßnahmen in der Pandemie. Das ist kein Unsinn, sondern gut untersucht. Aberglaube ist daher ein passender Nickname.
Wieviel Steuergelder müssen fließen, um solch ein totes Pferd zu reiten?
Alle!
@Bürger: Wieviel Dummheit muß man haben um nicht zu wissen, dass solcge Masken auch ohne Pandemie gebraucht werden, z.B. in Handwerk, Industrie und Gesundheitswirtschaft. Aber wozu Kühlschränke, es gibt ja Eisblocks, wozu Herde, es gibt ja Feuer …..
„Wieviel Dummheit muß man haben […]“
Nicht doch, auf so eine Suggestivfrage schreit der Klops doch sofort „Hier! Hier! Hier!“
Wie sicher sind die Masken wohl für Bartträger?
Für Bartträger 100 Prozent sicher , wenn sie such vor der Nutzung rasieren.
Die können sich ihren hergestellten Mi.. selber über den Kopp ziehen. Es gibt keinen Cent für den Käse.
…aber „gewachsener Mist, oder selbstkristallisierend“ wäre ok?
Doch, gab es. Naja, es waren keine Cents, sondern ganze Euros. Viele.
Und Du solltest vielleicht auch mal überlegen, Dir eine dieser Masken über den Kopf zu ziehen, im Gegensatz zu der Plastiktüte, die Du da gerade aufhast, sind die nämlich sauerstoffdurchlässig.
Ich empfehle gummierte Gasmasken mit Sichtgläsern.
Gleich einen ABC Schutzanzug. Dann bist rundum geschützt