Erinnerung im Regen: Halle gedenkt der Pogromnacht von 1938 mit bewegender Stille – Gedenkmarsch durch die Stadt, Kranzniederlegungen am Jerusalemer Platz

Als um Punkt 17 Uhr die ersten Worte auf dem Universitätsplatz in Halle (Saale) erklangen, begann es zu regnen. Feiner Niesel, dann dichter werdend, als ob der Himmel selbst ein Zeichen senden wollte. Das stetige Fallen der Tropfen mischte sich mit dem Klang der Stimmen, die am Sonntagabend an die Opfer der Novemberpogrome von 1938 erinnerten. Die Stadt Halle (Saale) hatte gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) und der Jüdischen Gemeinde zur Gedenkveranstaltung geladen. Rund um das Podium standen Menschen dicht gedrängt, mit Regenschirmen und Kerzen in den Händen. Unter ihnen Vertreterinnen und Vertreter der Stadt, der Kirchen, der Politik – und viele Bürgerinnen und Bürger, die einfach da sein wollten, um zu erinnern.
Erinnerung als Verpflichtung
Den Auftakt der Gedenkstunde übernahm Karsten Müller, amtierender Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Halle-Saalkreis. Seine Worte durchdrangen die feuchte Abendluft: Er sprach von den Menschen, „die dem nationalsozialistischen Rassenwahn zum Opfer fielen“, und mahnte eindringlich, dass Antisemitismus und Hass auf Andersdenkende keine Relikte der Vergangenheit seien. Er zeichnete eine Linie von der Bücherverbrennung über die brennenden Synagogen bis hin zum Massenmord – und warnte, dass der Ruf „Nie wieder“ heute hörbar schwächer werde. Seine Worte erinnerten daran, wie schnell Ausgrenzung wieder salonfähig werden kann. „Es beginnt mit Worten, mit Schweigen, mit Wegsehen“, sagte er. „Und es endet mit Auslöschung.“ Viele der Anwesenden senkten die Köpfe. Die Stille danach war dicht und eindrücklich. Nur der Regen sprach weiter.

„Erinnerung heißt Verantwortung“ – Die Stimme der Jüdischen Gemeinde
Da Max Privorozki, der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Halle, krankheitsbedingt die Rede nicht übernehmen konnte, sprach an seiner Stelle Vorstandsmitglied Lolita Kornblum. Ihre Rede war eindringlich, sachlich und doch voller Emotion. Sie erinnerte daran, dass der Hass auf Jüdinnen und Juden in Deutschland wieder wächst – und dass antisemitische Verschwörungsmythen, wie sie seit dem Mittelalter existieren, neue Formen angenommen haben. Kornblum erinnerte an die Ritualmordlegenden vergangener Jahrhunderte, aber auch an den Anschlag auf die Synagoge im Oktober 2019, der Halle für immer geprägt hat. Kornblum wandte sich gegen aktuelle Tendenzen in Politik und Wissenschaft, die Israel dämonisieren oder den jüdischen Staat infrage stellen. Am Beispiel einer jüngst an der Universität Halle abgehaltenen Veranstaltung mit dem Titel „Völkermord in Gaza“ kritisierte sie die Einseitigkeit der Darstellung: Weder die israelische Perspektive noch die Realität des Hamas-Terrors seien berücksichtigt worden. Für sie sei das mehr als nur schlechte Wissenschaft – es sei gefährlich. „Wenn eine Veranstaltung ‘Völkermord in Gaza’ trägt, ohne die israelische Sicherheitslage, das Existenzrecht Israels und den Kontext des Hamas-Terrors angemessen zu beleuchten, entsteht ein gefährliches Ungleichgewicht.“ Sie warnte: Solche Diskurse könnten jüdisches Leben in Deutschland erneut unter Druck setzen. „Erinnerung heißt nicht nur Rückblick“, sagte sie. „Erinnerung heißt Verantwortung.“ Ihre Worte wurden mit stillem, respektvollem Applaus aufgenommen.
Gesetze der Ausgrenzung – Worte, die Unheil brachten
Nicole Tröger vom WUK-Theaterquartier las im Anschluss Passagen aus den NS-Gesetzen vor, die den Weg zur Entrechtung jüdischer Bürgerinnen und Bürger bereiteten. Ihre Stimme zitterte kaum merklich, als sie den Titel „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ verlas – ein juristischer Euphemismus für den Ausschluss jüdischer Menschen aus dem öffentlichen Dienst. Auch das „Reichsbürger-Gesetz“ und die „Verordnung zum Schutze des deutschen Blutes“ wurden genannt. Tröger erinnerte daran, dass 1938 selbst Neugeborene jüdischer Eltern nur bestimmte Vornamen tragen durften – andere mussten „Israel“ oder „Sarah“ hinzufügen. Die Aufzählung wirkte wie ein Trommelfeuer: Paragraph für Paragraph, Schritt für Schritt – der Weg in die vollständige Entmenschlichung wurde hörbar gemacht. Viele Anwesende schlossen die Augen, als wolle man das Ungeheuerliche nicht nur hören, sondern fühlen.

„Wehret den Anfängen“ – Mahnung der Kulturdezernentin
Halles Kulturdezernentin Judith Marquardt griff diesen Gedanken auf. In ihrer Rede zeichnete sie ein Bild der schleichenden Radikalisierung in den 1930er Jahren. Die Pogromnacht, sagte sie, sei nicht plötzlich gekommen – sie war der Kulminationspunkt einer jahrelangen Entwicklung. Mehr als 1.400 Synagogen seien in jener Nacht zerstört worden, jüdische Wohnungen geplündert, 124 Hallenserinnen und Hallenser in Konzentrationslager verschleppt worden. „Der 9. November 1938 hatte mehr als 24 Stunden“, sagte sie. „Er begann schon 1933 – und endete erst 1945.“ Marquardt warnte, dass auch heute wieder Tendenzen zu beobachten seien, die an die 1930er Jahre erinnerten: zunehmende Diskriminierung, populistische Hetze, offene Gewalt gegen Minderheiten. „Wehret den Anfängen“, appellierte sie. „Denn am Anfang stehen immer Worte.“
Vom Universitätsplatz zum Jerusalemer Platz
Nach der Veranstaltung auf dem Universitätsplatz setzte sich der Zug der Teilnehmenden schweigend in Bewegung – ein stiller Gang durch die Innenstadt, hin zum Jerusalemer Platz, dem Ort, an dem einst die Synagoge der Stadt stand. Am 9. November 1938 wurde sie niedergebrannt, zerstört von den Fackeln der Pogromnacht. Heute steht dort ein Mahnmal. Hier wurde das jüdische Totengebet gesprochen. Danach legten die Menschen Blumen nieder, entzündeten Kerzen, deren Flammen trotz des Regens lange standhielten. Unter den Teilnehmenden waren Stadtratsmitglieder, die Bundestagsabgeordnete Janina Böttger, Sachsen-Anhalts Justizministerin Franziska Weidinger sowie Stadtratsvorsitzender Guido Haak.

Ein Spiegel der Gegenwart
Während die letzten Kerzen niedergelegt wurden, war der Regen schwächer geworden. Auf den nassen Pflastersteinen spiegelten sich die Lichter, Gesichter, Schirme. Es war, als ob der Platz selbst das Gedenken aufgesogen hätte – als Ort der Erinnerung, aber auch der Mahnung. Das diesjährige Pogromgedenken in Halle stand damit exemplarisch für eine Gesellschaft, die sich immer wieder ihrer Verantwortung stellen muss. Nicht nur im Rückblick auf 1938, sondern auch im Blick auf das Heute – auf Debatten, in denen antisemitische Muster wieder Platz finden, auf die Gewalt gegen Jüdinnen und Juden, die im Alltag wieder spürbar wird, und auf die Verantwortung jeder und jedes Einzelnen. Und am Ende hatte Max Privorozki doch noch ein paar Worte – eine Mahnung bezüglich Judenhass: „Es endete 1945 nicht endgültig.“ Er hoffe mit Blick auf heutige Entwicklungen, dass so etwas nie wieder möglich werde.
Ein leiser Schluss
Als die Veranstaltung endete, blieb eine Gruppe Menschen noch lange stehen. Einige hielten die Kerzen in den Händen, andere stellten sie auf den Boden vor das Mahnmal. Der Regen hatte aufgehört. Nur ein paar Tropfen fielen noch von den Bäumen. Das Pogromgedenken in Halle war kein lautes Ereignis – es war ein stilles, ernstes, eindrückliches Zeichen dafür, dass Erinnerung lebendig bleiben muss. Vielleicht hatte der Himmel wirklich ein Signal gesendet an diesem Abend. Ein Zeichen dafür, dass Erinnern nie selbstverständlich werden darf.












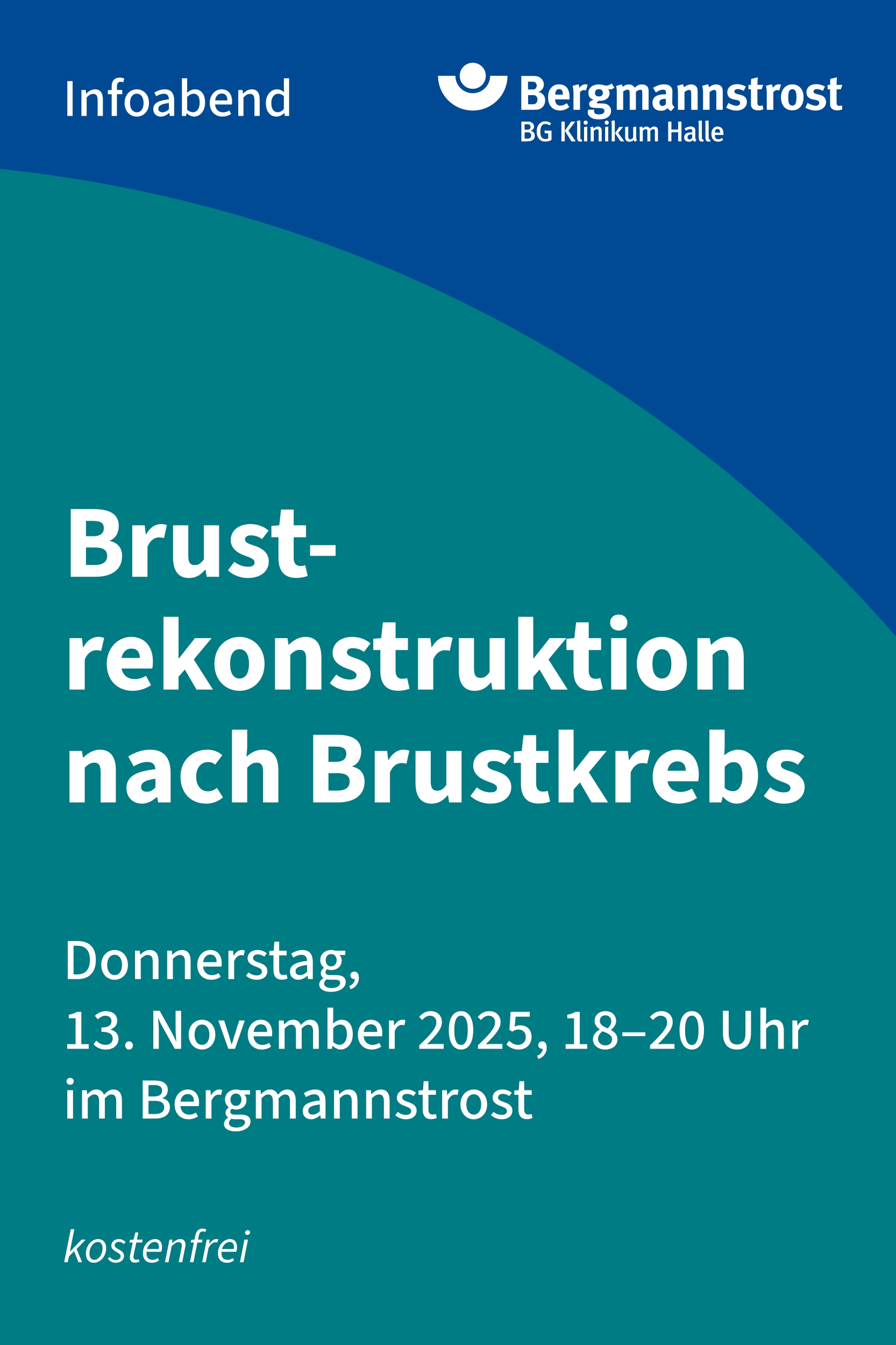








Neueste Kommentare