Amtsgericht Halle bestätigt Mieterhöhung: Genossenschaften dürfen nach Mietspiegel differenziert anpassen und bei fehlender Zustimmung mehr verlangen

Das Amtsgericht Halle (Saale) hat entschieden, dass eine Wohnungsgenossenschaft von einem Mitglied eine höhere Miete verlangen darf, auch wenn andere Genossenschaftsmitglieder zuvor freiwillig einer geringeren Erhöhung zugestimmt haben. Das Urteil vom 23. September 2025 (Az. 95 C 839/25) beleuchtet ein sensibles Spannungsfeld zwischen dem wirtschaftlichen Interesse einer Genossenschaft und ihrem rechtlichen Auftrag zur Gleichbehandlung ihrer Mitglieder.
Der Fall: Wenn aus Nachbarn Kläger und Beklagte werden
Die Klägerin, eine Wohnungsgenossenschaft mit Sitz in Halle (Saale), besitzt mehrere Wohnblöcke in der Stadt. Wie viele andere Vermieter orientierte sie sich bei der Miete an dem qualifizierten Mietspiegel der Stadt Halle, der im letzten Jahr erstnal aufgestellt wurde. Im Jahr 2025 sah der Mietspiegel eine deutliche Anhebung der ortsüblichen Vergleichsmiete vor. Die Genossenschaft wollte diesen Spielraum nutzen und ihren Mitgliedern eine Mieterhöhung vorschlagen. Allerdings ging sie dabei nicht starr nach Mietspiegelwerten vor, sondern bot zunächst allen Mietern eine freiwillige Mieterhöhung um 40 Euro monatlich an – deutlich weniger als der Mittelwert des Mietspiegels vorsah. Ziel war es, Streitigkeiten zu vermeiden und zu einer einvernehmlichen Lösung zu kommen. Viele Genossenschaftsmitglieder nahmen dieses Angebot an. Eine Mieterin, die zugleich Mitglied der Genossenschaft ist, lehnte die Erhöhung jedoch ab. Ihre Argumentation: Sie zahle bereits seit über zwanzig Jahren die höchste Miete im gesamten Wohnblock. Eine weitere Erhöhung sei daher nicht nur unzumutbar, sondern auch ein Verstoß gegen den genossenschaftlichen Gleichbehandlungsgrundsatz. Die Genossenschaft sah dies anders. Sie verklagte die Mieterin auf Zustimmung zu einer Mieterhöhung um 87,86 Euro, was dem Mittelwert des Mietspiegels entsprach.
Das Urteil: Keine Pflicht zur „Angleichung nach unten“
Das Amtsgericht Halle (Saale) gab der Genossenschaft Recht. Nach Auffassung des Gerichts war die Mieterhöhung rechtlich wirksam und auch mit dem Gleichbehandlungsgebot im Genossenschaftsrecht vereinbar. Zwar verpflichtet dieser Grundsatz jede Genossenschaft dazu, ihre Mitglieder gleich und willkürfrei zu behandeln. Unterschiede sind aber zulässig, wenn sie auf sachlichen Gründen beruhen. Das Gericht stellte klar, dass sich die ursprünglichen Miethöhen in der Genossenschaft historisch entwickelt hatten – abhängig von Marktbedingungen und der jeweiligen Vermietungssituation zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses. Diese Unterschiede dürfe eine Genossenschaft fortführen, solange sie nicht ohne sachlichen Grund einzelne Mitglieder benachteilige. Eine Pflicht, alte Mietunterschiede im Laufe der Zeit durch gezielte „Nachbesserungen“ oder besondere Rücksichtnahmen auszugleichen, bestehe nicht. Im Gegenteil: Eine unterschiedliche Behandlung bei der Mieterhöhung – also etwa geringere Erhöhungen für jene, die schon lange eine hohe Miete zahlen – würde selbst gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz verstoßen, weil sie die übrigen Mitglieder ohne sachlichen Grund benachteiligen könnte.
Ein transparenter Weg zur Mieterhöhung
Besonderes Gewicht legte das Gericht auf das Verfahren, das die Genossenschaft gewählt hatte. Diese hatte allen Mietern offen dargelegt, dass sie laut Mietspiegel eigentlich zu einer deutlich höheren Anpassung berechtigt sei. Aus Rücksicht auf die Mitglieder habe man sich aber auf ein freiwilliges Angebot von 40 Euro Erhöhung beschränkt. Die Genossenschaft habe dieses Vorgehen transparent angekündigt und einheitlich umgesetzt: Wer der Erhöhung um 40 Euro zustimmte, blieb davon verschont, wer die Zustimmung verweigerte, wurde auf den regulären Mietspiegelwert verklagt. Diese Vorgehensweise, so das Amtsgericht, sei willkürfrei, nachvollziehbar und sachlich gerechtfertigt. Ein Verstoß gegen die Gleichbehandlung sei gerade nicht ersichtlich – vielmehr würde es gegen das Gebot verstoßen, wenn die Genossenschaft einzelne Mieter ohne sachlichen Grund aus den gerichtlichen Verfahren herausnähme.
Rechtlicher Hintergrund: Zwischen Vereinsprinzip und Mietrecht
Wohnungsgenossenschaften nehmen im Mietrecht eine besondere Rolle ein. Sie sind nicht gewinnorientierte Unternehmen, deren Zweck darin besteht, ihren Mitgliedern preiswerten und sicheren Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Zugleich sind sie aber Vermieter – und damit Teil des allgemeinen Mietrechts. Dieses Spannungsverhältnis wird besonders deutlich, wenn die Genossenschaft ihre Mieten anpassen will. Nach § 16 Abs. 1 Genossenschaftsgesetz (GenG) gilt der Grundsatz der Gleichbehandlung: Kein Mitglied darf ohne sachlichen Grund bevorzugt oder benachteiligt werden. Auf der anderen Seite steht das bürgerliche Mietrecht (§§ 558 ff. BGB), das jeder Vermieterin erlaubt, die Miete an die ortsübliche Vergleichsmiete anzupassen. Wenn eine Wohnungsgenossenschaft also Mieterhöhungen vornimmt, muss sie stets beide Regelungsebenen im Blick behalten: Sie darf die Miete nach BGB erhöhen, muss dabei aber genossenschaftsrechtlich gerecht handeln. Das Urteil aus Halle zeigt, dass diese beiden Ebenen nicht im Widerspruch stehen müssen, solange die Genossenschaft sachliche und transparente Kriterien beachtet.
Was bedeutet das Urteil für Genossenschaftsmitglieder?
Für Mitglieder von Wohnungsgenossenschaften ist die Entscheidung von Bedeutung, weil sie deutlich macht: Die Mitgliedschaft in einer Genossenschaft bietet zwar Schutz vor willkürlichen oder unangemessenen Mieterhöhungen, aber keine Garantie für dauerhaft niedrigere Mieten. Eine Genossenschaft darf – wie andere Vermieter auch – die Miete nach Mietspiegel erhöhen. Der Gleichbehandlungsgrundsatz schützt nur davor, dass einzelne Mitglieder ohne sachlichen Grund schlechter gestellt werden. Im konkreten Fall war die Mieterin nicht deshalb benachteiligt, weil sie verklagt wurde – sondern weil sie das freiwillige Angebot nicht angenommen hatte. Die Klage auf den höheren Betrag war daher rechtlich konsequent.
Juristische Bedeutung über den Einzelfall hinaus
Das Urteil des Amtsgerichts Halle (Saale) reiht sich in eine Reihe von Entscheidungen ein, die die Rolle der Genossenschaften als „soziale, aber wirtschaftlich handelnde Vermieter“ stärken. Gerichte betonen zunehmend, dass Genossenschaften zwar besondere soziale Pflichten haben, aber nicht dazu verpflichtet sind, wirtschaftliche Nachteile hinzunehmen, um alle Mitglieder auf ein einheitliches Mietniveau zu bringen.
Für die Praxis bedeutet das: Transparenz und sachliche Begründung bleiben das wichtigste Kriterium bei Mieterhöhungen. Freiwillige Kompromissangebote sind zulässig, solange sie offen kommuniziert und einheitlich angewendet werden. Mitglieder, die solche Angebote ablehnen, müssen mit der Anwendung der regulären mietrechtlichen Vorschriften rechnen.
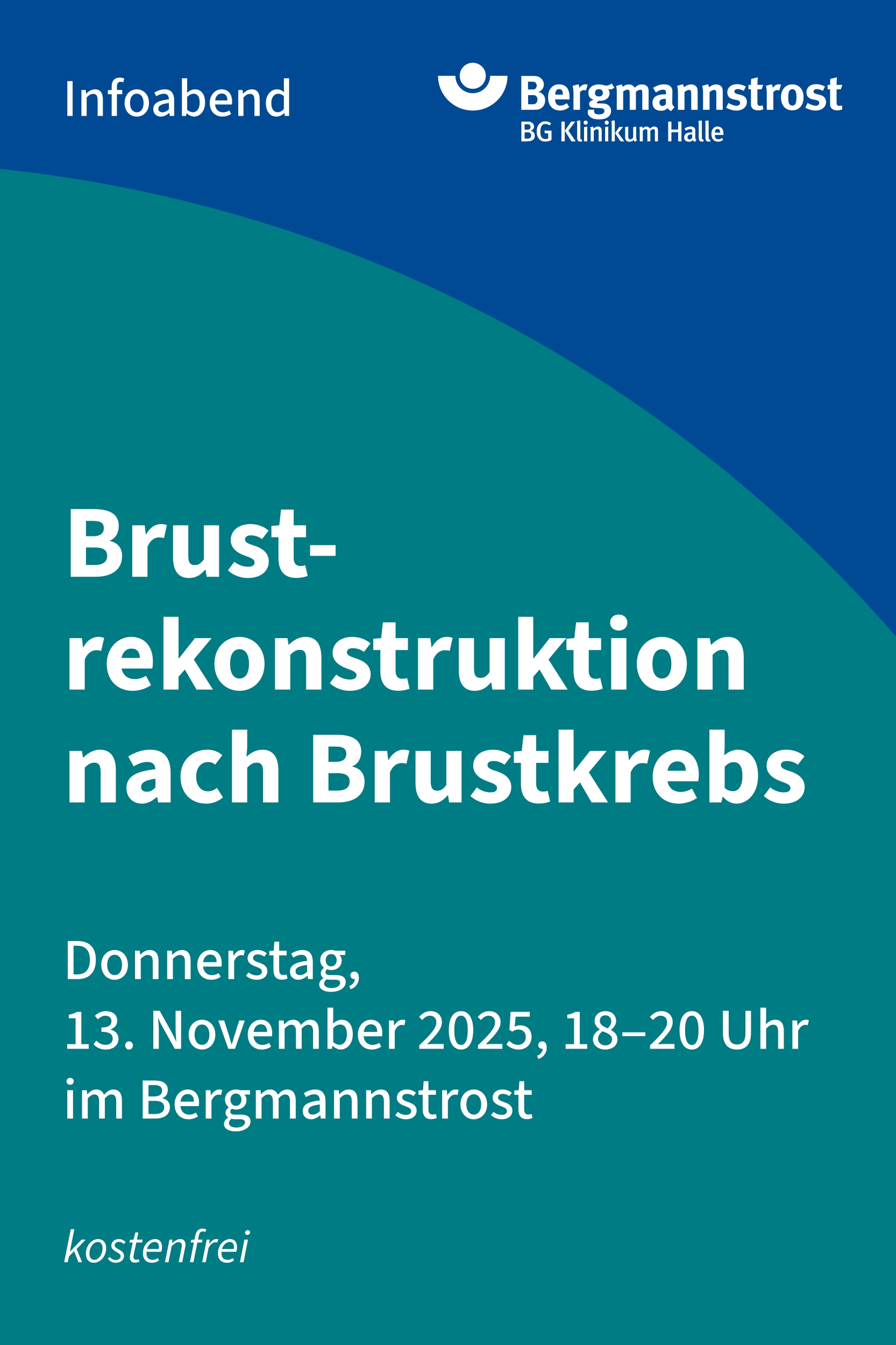









Genau so geht es uns auch. Wir wohnen ganz oben in der 5. Etage und zahlen die höchste Miete im Block. Gerade diese Wohnungen ganz oben sind durch fehlende Aufzüge ( 76 Stufen) für neue Mieter unantraktiv. Somit kann die Genossenschaft froh sein dass diese Wohnungen überhaupt bezogen werden.
Mit anderen Worten, wer am Hebel sitzt hat die Macht. Der Kleine zieht immer den kürzeren.
Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm das will.
Wer sitzt denn deiner Meinung nach in einer Genossenschaft am Hebel, wenn nicht die Mehrheit der Genossinnen?