Designpreis für queere Geschichtsschreibung: Ludwig II. zwischen Identität und Mythos

Am Mittwoch wurden in Halle (Saale) die GiebichenStein Designpreise verliehen – ein Termin, der jedes Jahr zeigt, wie viel junge gestalterische Kraft von der Kunsthochschule Burg Giebichenstein ausgeht. Unter den erneut vielfältigen Projekten stach diesmal besonders eine Arbeit hervor, die nicht nur ästhetisch, sondern auch historisch und politisch aufhorchen lässt: „Kini, Kitsch & Krypto“ von Leon Sebastian Leiß, ausgezeichnet vom Stadtmuseum Halle. Die Modedesign-Arbeit, betreut von Prof. Lars Paschke, wird künftig eine noch breitere Öffentlichkeit erreichen. Aktuell sind zwei der Entwürfe in der Kunststiftung Sachsen-Anhalt am Neuwerk zu sehen. Danach wandern sie für ein Jahr in das Stadtmuseum Halle – und werden dort Teil der ständigen Ausstellung. Auch eine Modenschau im Rahmen der Händelfestspiele 2026 ist geplant. Ein bemerkenswerter Weg für eine Bachelorarbeit, die sich tief in historische Schichten eingräbt und sie mit gegenwärtigen Perspektiven neu verwebt.
Ein König im Spiegel queerer Geschichte
Im Zentrum des Projekts steht König Ludwig II. von Bayern, die schillernde Figur des 19. Jahrhunderts, die bis heute Stoff für Mythen, Bewunderung und Projektionen liefert. Leiß begegnet Ludwig II. jedoch nicht als Märchenkönig überzuckerter Sagenwelt. Er nimmt ihn vielmehr als Menschen ernst – in all seinen Brüchen, Zugehörigkeiten und dem, was die offizielle Geschichtsschreibung lange marginalisierte: seine Homosexualität. Leiß wuchs selbst in Bayern auf. Geschichten über Ludwig II. begleiteten ihn schon früh. In vielen Erzählungen, so beschreibt er, werde Ludwig gern als „psychisch kranker Märchenkönig“ charakterisiert. Doch ein bedeutender Teil seiner Identität bleibe dabei fast immer außen vor: sein Begehren, sein Liebesleben, sein queeres Selbst. Leiß’ Arbeit setzt genau hier an. Mit künstlerischen Mitteln seziert er jene Überlieferungen, die Ludwig II. zu einer entrückten Figur machten – und zeigt, wie stark die Mechanismen des Verschweigens und Umschreibens bis heute nachwirken. Besonders deutlich wird das in der Bearbeitung eines historischen Fotos, auf dem die Hand von Ludwigs mutmaßlichem Liebhaber entfernt wurde. Diese Manipulation nimmt Leiß zum Ausgangspunkt für textile Eingriffe, Retuschen, fragmentierte Drucktechniken und Materialien, die vom Verbergen queerer Biografien erzählen. Die Arbeit zeigt, wie Geschichtsbilder nicht nur über Worte, sondern auch über Bildpolitiken konstruiert werden – und wie man diese Bilder öffnen kann.
Mode als Archiv: Stoffe, die erzählen
Wie lässt sich Geschichte in Mode übersetzen? Leiß antwortet darauf mit einem präzisen Vokabular aus Symbolen, Materialien und textilen Codes. Leder, Spitze und Denim verweisen auf queere Ästhetiken, auf Erotik, auf Subkulturen und Widerstandsgesten, die seit Jahrzehnten zur queeren Kultur gehören. Dekonstruktionstechniken machen historische Eingriffe sichtbar und untergraben zugleich die glatten Oberflächen der Überlieferung. Queere Symbole verschmelzen mit Motiven des bayerischen Königtums. Besonders markant ist ein Mantel, dessen traditionelle weiß-blaue Bayernraute zu einem Dreieck zusammengezogen ist. Leiß formt daraus eine Referenz auf das rosa Dreieck – jenes Symbol, das die Nationalsozialisten nutzten, um schwule Männer in den Konzentrationslagern zu markieren und zu stigmatisieren. Dieser Eingriff macht sichtbar, wie politische Bedeutungen ineinanderfließen: Das bayerische Landeszeichen, das Ludwig II. repräsentiert, kippt in ein Symbol des queeren Leidens, der Erinnerung und des Widerstands. Gleichzeitig wird die Frage aufgeworfen, wie sich historische Identitäten verschränken lassen – und wie Mode als Medium fungieren kann, das diese Schichten aufbricht. Leiß stellt klar, wie wichtig ihm der reflektierte Umgang mit Geschichte ist, gerade angesichts gesellschaftlicher Entwicklungen der Gegenwart. Seine Arbeit signalisiert: queere Geschichte ist kein Randthema, sondern ein zentraler Bestandteil historischer Erinnerungskultur.
Zwischen Selbstverwirklichung und Verdrängung: Die Geschichte Ludwig II. neu gelesen
Die queere Biografie Ludwig II. ist ein Thema, das lange tabuisiert wurde. Leiß macht darauf aufmerksam, dass Ludwig II. kurz vor seinem Tod im Jahr 1886 wegen „moralischen Irreseins“ entmündigt wurde – ein Vorwurf, der eng mit seiner Homosexualität verbunden war. Leiß beschreibt, wie schwer es für Ludwig II. gewesen sein dürfte, seine Identität öffentlich zu leben. Aus Tagebucheinträgen lassen sich Hinweise auf sein Begehren herauslesen, doch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen änderten sich in Bayern im Laufe des 19. Jahrhunderts stark. Während Anfang des Jahrhunderts homosexuelle Praktiken durchaus Freiräume hatten – auch im städtischen Kontext Münchens – verschärfte sich das gesellschaftliche Klima um die Mitte des Jahrhunderts zunehmend. Leiß verweist darauf, dass sich die Stimmung stark gewandelt habe, auch im Kontext erstarkender rechter Bewegungen in Bayern. Für das Projekt bedeutet diese historische Einordnung zweierlei: Zum einen wird sichtbar, wie politische und moralische Systeme queere Identitäten verdrängen. Zum anderen zeigt sich, dass die Mechanismen, die Ludwig II. trafen, auch heute noch spürbar sind – sei es in öffentlichen Debatten, ästhetischen Codes oder in der Frage, wie queere Biografien erzählt (oder verschwiegen) werden.
Eine Arbeit zwischen Museum, Bühne und Mode
Dass das Stadtmuseum Halle „Kini, Kitsch & Krypto“ auszeichnet, ist mehr als eine Anerkennung gestalterischer Qualität. Es ist auch eine Entscheidung, queere Perspektiven in die ständige Ausstellung aufzunehmen – und damit ein dauerhaft sichtbares Zeichen für Vielfalt, historische Präzision und kulturelle Aktualisierung zu setzen. Die Präsentation in der Kunststiftung am Neuwerk und die spätere Modenschau im Rahmen der Händelfestspiele schaffen weitere Räume, in denen Leiß’ Arbeit wirken kann. Gerade die Übersetzung in eine Modenschau dürfte die performative Dimension des Projekts betonen: Kleidung als wandelbare Oberfläche, als Bühne, als politische Geste. Für ein Stadtmagazin ist diese Entwicklung mehr als bemerkenswert. Sie zeigt, wie eng die kulturellen Institutionen Halles zusammenarbeiten – und wie junge Künstlerinnen und Künstler Impulse setzen, die weit über das Design hinausreichen.
Was bleibt: Ein neues Narrativ für einen alten König
„Kini, Kitsch & Krypto“ ist ein Projekt, das mit den Mitteln der Mode historische Leerstellen sichtbar macht. Leiß legt nicht einfach neue Stoffe über alte Geschichten; er trennt sie auf, legt Unterfäden frei, zeigt, wie Identitäten konstruiert und wieder verborgen wurden. Sein Werk lässt Ludwig II. nicht als entrückte Märchenfigur erscheinen, sondern als Menschen, dessen Geschichte in queeren Kontexten neu gelesen werden kann. Und es fragt zugleich, wie queere Identität heute verhandelt wird – in Bayern, in Halle, in Museen, auf der Straße. Dass diese Auseinandersetzung in einem Stadtmuseum ihren Platz findet, ist ein Signal. Für die Studierenden der Burg Giebichenstein ist es eine Anerkennung. Für die Stadt Halle ein kultureller Gewinn. Und für die Besucherinnen und Besucher ein Angebot, Geschichte neu zu denken.



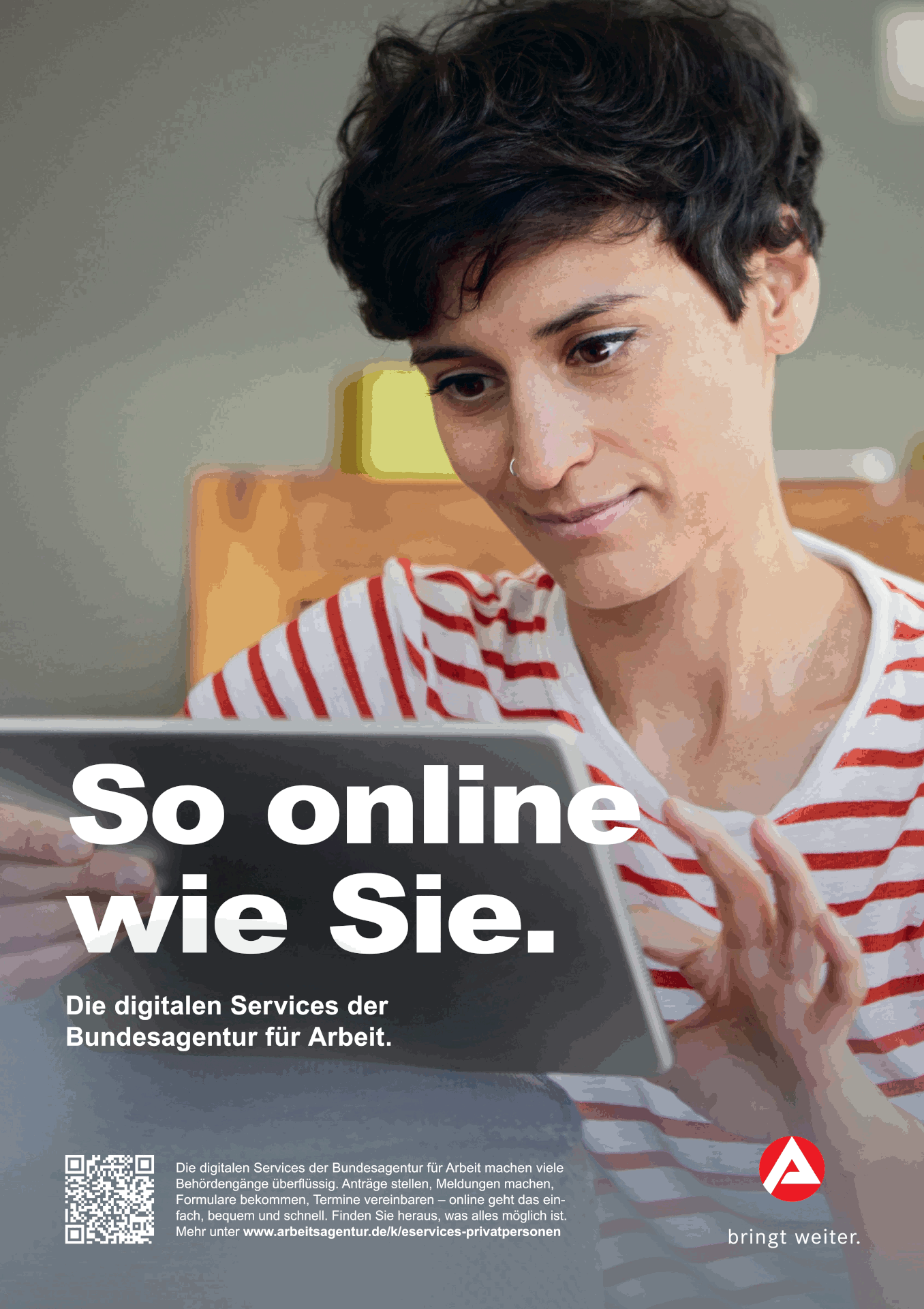




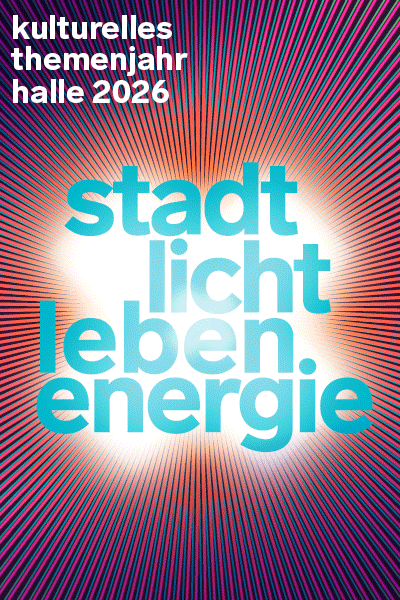



Wenn man so viel Schwurbeltext braucht, um sein Kunstwerk zu erklären, dann ist das nur abgehobener Unsinn, der genauso schnell wieder in der kognitiven Versenkung verschwindet wie er gekommen ist. Gute Kunst spricht für sich selbst. Man stelle sich mal vor, Leonardo da Vinci hätte erst einen Aufsatz über das Gemälde der Mona Lisa geschrieben, um seine Absicht und Gedanken dahinter zu erkären. 🙄
Ich finde auch, dass die Deutung von Kunst in erster Linie die Aufgabe des Empfängers sein sollte, möglichst keine Deutungshoheit durch den Künstler vorgegeben wird.
Aber woher willst du wissen, dass der Künstler den Text geschrieben hat („Wenn man so viel Schwurbeltext braucht, um sein Kunstwerk zu erklären..“
Schreibst du auch deine vielen Schwurbeltexte selber?
Die Absicht hinter einem Kunstwerk, die Umstände der Entstehung, geschichtliche Zusammenhänge, die Bedeutung dieses Schaffens…dafür interessieren sich sicherlich nicht alle dbH-Kommentator*innen. Aber es ist doch schön, dass das auch ein Teil dieser „Nachrichtenpinnwand“ hier sein darf. Es stört vielmehr, dass du dein Nicht-Interesse hier bekunden musst.
Man stelle sich mal vor, Nulli würde sich nicht zu jedem Thema äußern und seine bisweilen sehr verquere Meinung, seine Absicht und Gedanken dahinter kundtun. Was für eine Wohltat wäre das…
Hihi, „verquer“.
Ist okay, wenn es dir zu viel Text war, Herr Nulli. Wir gratulieren der Person zu Ihrer Kunst und dem Preis. Glückwunsch.
Du gratulierst als Kumpel.
„Gute Kunst spricht für sich selbst.“ Das ist doch Quatsch, oder?
… dann wüsste wir gewiss mehr. Denn warum werden bis heute ganze Bücher darüber verfasst, die der Frage nachgehen, wer überhaupt dargestellt ist?!
Respekt, spannende Perspektive!
Und das Kufiyah-Muster in Solidarität mit Palästina ist auch klasse 🙂
„Kleidung als wandelbare Oberfläche, als Bühne, als politische Geste.“
Es ist nicht das Muster der Kopfwindel.
Zusatzfrage: Feierst Du, dass in „Palästina“ Homosexuelle öffentlich von Hochhäusern geworfen werden? So als politische Geste?
Würde mich auch freuen, wenn man statt Märchenprinzen mal normale Familien, wo die Eltern vernünftiger Arbeit nachgehen und die noch zusätzlich zwei oder drei Kinder großziehen, als Vorbild heranziehen würde. Das sind die Leute, die unserer Gesellschaft den größten Nutzen bringen. Durch Erzeugen von Mehrwert und durch Bekämpfung des demographischen Wandels.
Habe ich die „normale“ Familie nicht ständig präsent? Auf der Straße, im Beruf, in der Werbung, im Film …?
Und muss wirklich alles immer einen unmittelbaren Nutzen habe? Das wäre doch quälend und langweilig. Nicht einmal in einer „normalen“ Familie hat alles einen Nutzen. Hoffentlich.
Lange nicht mehr so gelacht. So ein Quark.
https://de.wiktionary.org/wiki/krypto-
Großartig, wenn man sich im Modedesign eines solchen Themas und einer solchen Frage annimmt. Daher Gratulation! – Der vermeintliche „Liebhaber“ war aber keiner: Der junge Schauspieler Josef Kainz reiste mit Ludwig II. durch die Schweiz. Zum Abschluss der Reise ließen sich beide in Luzern fotografieren. Dabei griff der stehende Schauspieler an den oberen Abschluss des Stuhles, auf dem der König sitzt. Das war eine unbotmäßige Nähe, daher wurde das Foto retuchiert. Aussagen, der Schauspieler habe seine Hand auf die Schulter des Köänigs gelegt, sind falsch.
Solcher Käse darf nicht unprämiert bleiben. Was für ein Quatsch.
Danke all den Märchenschribenten hier in der Kommi-Zone. Deren Botschaften sind noch luschticker als der PR-Text der Künstler.
Wer queere Kunst macht, hat eine Auszeichnung schon mal sicher. Die Käufer stehen schon Schlange.