Pogromgedenken: Flüchtlinge müssen Judentum akzeptieren

Am 9. November 1938 brach auch über Halle die Pogromnacht herein. Jüdische Geschäfte und Wohnungen geplündert und in der sogenannten „Reichskristallnacht“ 124 jüdische Männer ins Konzentrationslager Buchenwald verschleppt. In den folgenden Jahren wurden viele weitere Hallenser Juden in die Vernichtungslager der Nationalsozialisten deportiert, auch 33 Sinti und Roma aus der Saalestadt wurden auf diese Reise in den Tod geschickt. Am Mittwoch wurde am Jerusalemer Platz am Denkmal für die abgebrannte Synagoge, an die Ereignisse erinnert.
Bürgermeister Egbert Geier wies in seiner Rede auf die wieder wachsende jüdische Gemeinde in Halle hin. „Wir spüren die kulturelle und menschliche Bereicherung, die auch mit dem Zuzug von Menschen jüdischen Glaubens entstanden ist. Und wir werden alles tun, um ein tolerantes Miteinander zu gewährleisten.“ Dennoch benötige man auch die Erinnerung „gerade an die Abgründe unsere deutschen, unserer Menschheitsgeschichte“, so Geier. „Ohne Erinnerung hat eine Gemeinschaft keine Orientierung, keine Identität.“ Geier erinnerte auch an die vielen ermordeten, gefolterten und deportierten Menschen in jüngster Zeit. Auch deshalb sei es sehr wichtig, „dass wir uns erinnern.“ Explizit griff er dabei die Familie Herschkowicz, die nach Polen deportiert wurde und dort ums Leben kam. Geier griff sich dabei insbesondere das Schicksal der Tochter Hanna heraus, die im Alter von zwölf Jahren starb. „Erinnerung, Nächstenliebe und Mitgefühl sind eine gute Basis für unsere Zukunft. Diese Zukunft werden wir nur gemeinsam bestehen, im friedlichen und toleranten, im weltoffenen Miteinander aller Religionen und Weltanschauungen.“ Zudem erinnerte Geier an die sogenannte „Polenaktion“, die wenige Tage vor der Pogromnacht stattfand. Der gebürtige Hallenser Reinhard Heydrich ließ zwischen zahlreiche Juden verhaften, allein in Halle waren es 120.
Superintendent Hans-Jürgen Kant sprach für die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen. Zum ersten Mal mit dem Holocaust in Berührung gekommen sei er im Alter von 17 Jahren durch das Buch „Die Nacht“ von Elie Wiesel, im Kühlungsborner Gemeinderaum sei dies gewesen. Man habe damals über den Holocaust gesprochen „zu einer Zeit, in der das kein Thema, oder kaum ein Thema in der Schule war.“ In dem Buch hat Wiesel in Form eines Romas zu verarbeiten versucht, was er im Nationalsozialismus und im Konzentrationslager erlebt hat, so die Erhängung eines Kindes. Wiesel selbst hat seine Mutter und seine Schwester nach der Deportation nach Auschwitz nie wieder gesehen. „Finstere Nacht offenbart sich in diesen Zeilen von Elie Wiesel“, so Kant, „ein unerträgliches Maß an Grauen und eine Gottesverfinsterung, die geradezu aus den Worten eines Hiob oder ohnmächtiger Psalmbeter zu kommen scheint. Finstere Nacht als Endstation dessen, was 1933 in ganz Deutschland begonnen hat, was sich vor 78 Jahren mit den Pogromen in der Nacht vom 9. auf den 10. November entsetzlich steigerte“, so Kant, „und über 7 weitere Jahre in den Massenmord an unseren jüdischen Mitbürgern gipfelte.“ Das Erinnern am 9. November sei für ihn kein Ritual, das es zu absolvieren gelte und das eines Tages überholt sei. „Dieses Erinnern bleibt für mich über die Jahre lebendig. Nicht nur in den Einzelschicksalen, die mir vor Augen treten, von denen ich wie in dem Buch von Elie Wiesel bis heute lese und höre. Dieses Erinnern an das Grauen ist für mich nicht nur rückwärtsgewandt im Blick auf die Opfer von damals, sondern es zielt in unsere Gegenwart.“ Es gebe in jedem Menschen nicht nur den Willen zum Guten, sondern immer auch das Destruktive, das Zerstörerische, die Abgründe.“ Bereits die Bibel zeige dies, Kain erschlage seinen Bruder Abel. „Die Bosheit läuft in den Abgrund, in die Katastrophe der Sintflut. Menschen verlassen ihr eigenes Maß und wollen mit ihren Türmen wie Gott sein.“ Das Haus der menschlichen Möglichkeiten habe viele Spielräume. „Was einmal geschehen ist, kann sich trotz aller Aufklärung wiederholen, weil der Mensch so ist wie er ist. Mit seiner Angst, nicht genug berücksichtigt und angeschaut zu werden. Mit seinem Wahn, hinter meterhohen Mauern und mit Abschottung eine Zuflucht zu finden. Seine Heimat zu sichern. Und dann genau denen zuzujubeln, die seine Ängste mit markigen Worten bedienen und befeuern“, mahnte Kant. „Denjenigen, denen die Rechte von Minderheiten egal sind, die an einer demokratischen Gewaltenteilung kein Interesse haben, die Hass predigen.“ Doch der Mensch müsse nicht das Böse wählen. „Als Menschen können wir immer wieder neu uns für das Gute entscheiden“, so Kant weiter. „Sich die menschlichen Möglichkeiten vor Augen zu halten, darauf kommt es für mich an, an einem Tag wie heute, damit unsere Welt nicht wieder in einem Abgrund versinkt.“
Max Privorotzki, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde, sagte, er habe sich die Frage gestellt, ob die Gedenkveranstaltungen und Ansprachen überhaupt etwas bringen, oder ob diese nicht zum reinen Ritual verkommen seien. Die Entwicklungen der vergangenen Monate hätten gezeigt, dass die Menschheit sehr kurzsichtig sei. Kriege und bewaffnete Konflikte habe es auch nach Ende des zweiten Weltkriegs immer wieder gegeben. Doch seien Brutalität und Aggressivität in der letzten Zeit bedrohlich gestiegen, „dass man denken könnte, die Geschichte wolle sich unbedingt wiederholen.“ Auch die Entwicklung des Antisemitismus wirke wie ein Déjà-vu. Privorotzki nannte dabei beispielhaft die Verschwörungstheoretiker, die vom jüdischen oder jüdisch-amerikanischen Kapital sprechen und jeden Montag auch in Halle demonstrieren und zum Tag der Reichspogromnacht fast zeitgleich eine ihrer Kundgebungen am Riebeckplatz abhielten. Ebenso verurteilte er die „ständige antiisraelische Hetze, wie kürzlich im Fall einer Unesco-Jerusalem-Resolution.“ All dies hinterlasse ein Gefühl der Fassungslosigkeit. Die Aussage „Die Geschichte wiederholt sich“ scheine sich zu bestätigen. Er habe anfangs überlegt, auf eine Ansprache zu verzichten, „denn was bringen all die mahnenden Worte von ermordeten Frauen und Kindern, und über niedergebrannte Synagogen, wenn keine Verbindung zu den gegenwärtigen Entwicklungen gezogen wird.“ Doch die Erinnerung sei wichtig, gebe es doch immer weniger Zeitzeugen der Shoa, die Ereignisse verkommen zu bloßen Fakten auf einer Seite im Geschichtsbuch. Nötig seien derartige Veranstaltungen auch, um den gegenwärtigen Antisemitismus und die Bedrohung jüdischen Lebens zu thematisieren. Im Jahre 2006 seien 364 westeuropäische Juden nach Israel ausgewundert, im vergangenen Jahr seien es 9.967 gewesen. Um diese Tendenzen zu stoppen, reichen Fachkonferenzen und Workshops nicht aus, so Privorotzki. Handlungen müssten folgen. Dazu zähle beispielsweise, dass hallesche Schulklassen im Rahmen des Unterrichts die Synagoge besuchen. Diese vor Jahren erfolgte Anregung sei bis heute nicht realisiert worden. Bei der Integration von Flüchtlingen reiche es nicht aus, ihnen die deutsche Sprache beizubringen und bei der Jobsuche behilflich zu sei. „Eine erfolgreiche Integration bedeutet auch, dass die Neuzugewanderten das deutsche Judentum als untrennbaren Teil der deutschen Gesellschaft verstehen und akzeptieren lernen. Und das in allen Aspekten, von der Kultur und Religion über die Geschichte bis hin zu der von der Bundeskanzlerin propagierten Staatsräson: die Sicherheit und das Existenzrecht Israels haben einen besonderen Stellenwert“, so Privorotzki. Ein weiterer Grund für die Gedenkstunde sei das Beten. „Nur der Glaube an Gott und den von ihm erschaffenen Menschen bringt uns Kraft.“ Dies sei auch für die Seelen der ermordeten Menschen von immenser Wichtigkeit. Im Anschluss folgte das Kaddisch, eines der wichtigsten jüdischen Gebete.








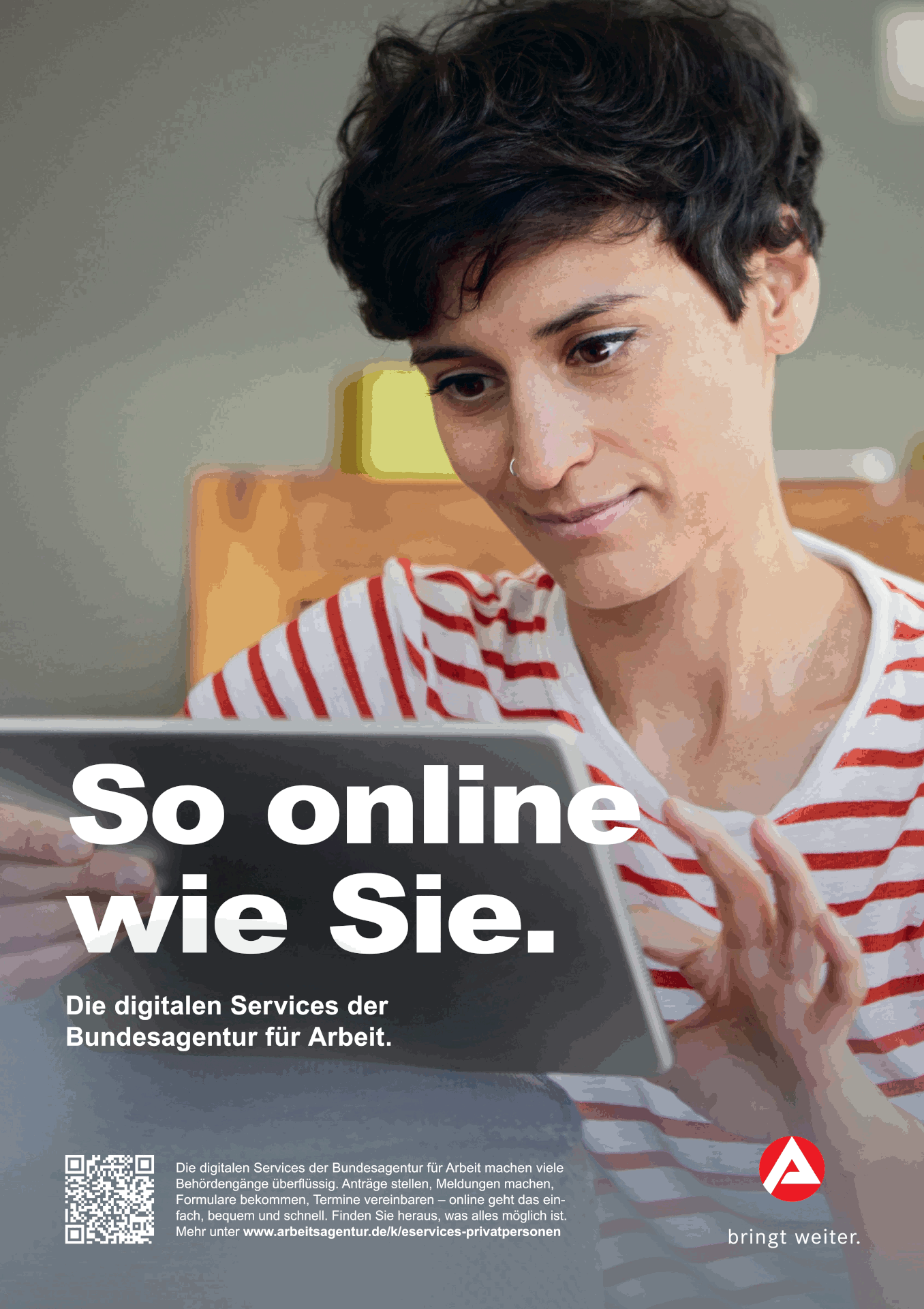

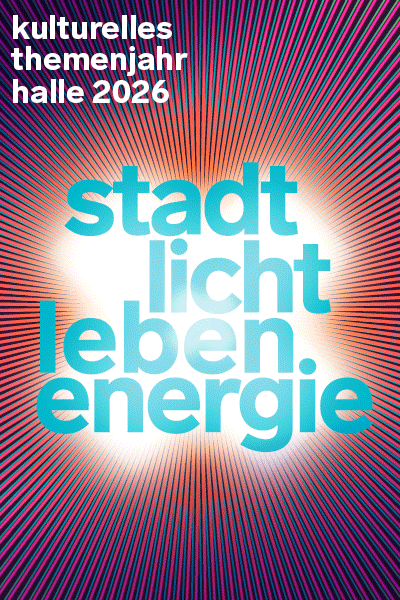




Neueste Kommentare