„Kein verfassungsfeindlicher Inhalt“ – BURG verteidigt künstlerische Freiheit zur Jahresausstellung – rechtliche Maßnahmen gegenüber Antisemitismus-Vorwürfen werden geprüft

Die diesjährige Jahresausstellung der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle hat zu einer intensiven öffentlichen Diskussion geführt. Im Zentrum stehen Vorwürfe, einzelne Beiträge enthielten antisemitische Inhalte oder zumindest politisch problematische Botschaften. Die Hochschulleitung der BURG hat nun in einer offiziellen Stellungnahme auf die Kritik reagiert und sich klar zur Situation positioniert.
Diskussion um Modenschau und Publikation
Auslöser der Debatte war zunächst das Finale der Werkschau Mode am vergangenen Freitag. Beobachter hatten sich über einzelne Kleidungsstücke gewundert und Fragen nach deren politischer Aussagekraft gestellt. Die Hochschule stellt in ihrer Stellungnahme klar, dass sie „die Kleidung von Studierenden nicht bewertet – weder in Bezug auf konkrete Muster noch hinsichtlich möglicher politischer Aussagen“. Eine Ausnahme stelle allein verfassungsfeindlicher Inhalt dar – dieser sei im vorliegenden Fall jedoch nicht gegeben, so die BURG.
Ein weiterer Kritikpunkt war eine studentische Zeitung, die während der Ausstellung verteilt wurde. Darin wurde zur Solidarität mit Künstlerinnen und Designerinnen in Palästina aufgerufen. Auch hierzu bezieht die Hochschule deutlich Stellung: Es handele sich nicht um eine Publikation der Hochschule, sondern um ein eigenständig verantwortetes Projekt von Studierenden. Die BURG distanziert sich somit formal von der inhaltlichen Verantwortung.
Kunstwerk unter Verdacht: Offizielle Stellungnahme veröffentlicht
Für besonders kontroverse Diskussionen sorgte ein Kunstwerk auf dem Campus Kunst. Der Vorwurf: Das Werk enthalte ein antisemitisches Motiv. Bereits am Sonntag, dem 13. Juli 2025, veröffentlichte die Hochschule hierzu eine Stellungnahme. Demnach handelt es sich um ein abstraktes Relief ohne Titel, das bereits 2024 Teil der damaligen Jahresausstellung war. Die Hochschule stellt klar:
„Es enthält als solches keine figurativen Motive, die genaue Form ist aus einem plastischen Prozess entstanden, dessen Ergebnis eben genau nicht eindeutig lesbar sein soll. […] Vom Künstler intendiert ist ausdrücklich kein einziges figuratives Motiv.“
Neu sei in diesem Jahr lediglich eine farbliche Bearbeitung des Werks, mit der der Künstler seine Empathie mit der Zivilbevölkerung im Gaza-Streifen ausdrücken wollte. Das Leid dort beschäftige ihn zutiefst. Auch dies wertet die Hochschule nicht als antisemitische Äußerung, sondern als Ausdruck individueller künstlerischer Auseinandersetzung mit einem politischen Thema.
Kunstfreiheit versus Verantwortung
Die Leitung der BURG verweist in ihrer Stellungnahme auf die im Grundgesetz verankerte Kunstfreiheit – ein hohes Gut, das insbesondere im Rahmen einer Kunsthochschule einen besonderen Stellenwert einnimmt. Gleichzeitig betont sie, dass der Vorwurf des Antisemitismus schwerwiegend sei und man entsprechende Hinweise ernst nehme.
Die Hochschulleitung kritisiert jedoch die Art und Weise der öffentlichen Diskussion. Diese basiere zum Teil auf „Mutmaßungen und falschen Darstellungen“. Man prüfe derzeit rechtliche Schritte, um gegen unwahre Behauptungen vorzugehen.








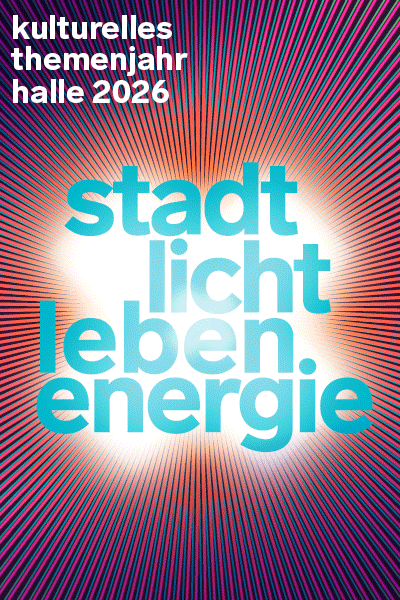



Na los! Wer „erklärt“ hier jetzt, dass wir gar keine Verfassung haben?!
„Kein verfassungsfeindlicher Inhalt“ – BURG verteidigt künstlerische Freiheit zur Jahresausstellung“
Seit wann hat „die Burg“ darüber zu entscheiden, ob es sich um verfassungsfeindliche Inhalte handelt oder nicht? Das muss eine unabhängige Justiz überprüfen und nicht die Führung „der Burg“.
„rechtliche Maßnahmen gegenüber Antisemitismus-Vorwürfen werden geprüft“
Mit dieser Aussage versucht man offenbar, meinen Parteikollegen Konstantin Pott einzuschüchtern. Wir als FDP werden allen, die Antisemitismus relativieren, den Weg zur Tür weisen.
Und du entscheidest, dass hier Antisemitismus relativiert wird? Haben das nicht auch Gerichte zu entscheiden? Und nicht du und deine Stammtischkollegen von der ehemaligen FDP? Du widersprichst dir innerhalb eines Kommentars.
Mach dich nicht lächerlich. Die Burg interessiert nicht, was irgendein unbedeutender Lokalpolitiker einer noch unbedeutenderen Partei für geisige Ergüsse von sich gibt. Es geht um die Initiatoren des Aufrufs.
Find ja geil, dass einerseits auf Kunstfreiheit berufen wird („Was können wir für die Ausstellungsstücke der Künstler:innen“), andererseits wird dann Kritik daran gerügt und man prüft „rechtliche Schritte“. Im Grunde ist das natürlich auch typisch deutsch. Man verlangt Freiheit für sich selbst („Was irgendwelche bürgerlichen Studis für Zeitungen drucken ist uns egal“), andererseits wird anderen eine solche Freiheit nicht erlaubt („Wehe, die Öffentlichkeit kritisiert was wir hier machen“).
Jedes Jahr gibt es irgendwelche Kontroversen um die Burg, dabei ist das völlig egal, was dort passiert. Die Jahresausstellung kennt außerhalb Halles und irgendwelcher bürgerlichen Künstler:innenkreise niemand. Das Gros der Absolvent:innen eröffnet letztlich maximal für 3 Monate nach Abschluss einen Pop-Up-Store in der hallenser Innenstadt und fängt dann – wie die meisten leider hier – einen normalen Job an, weil man von der Kunst nicht leben kann (eben außer als unbefristete Hochschulleitung einer sachsen-anhalter Kunsthochschule.
Sollen die Studis doch was zu Gaza machen, das Leid dort verändert eine Studizeitung nicht, aber in einer Generation von Vibes und Selbstzweifeln ist das doch harmlos und letztlich nur Selbstzweck.
Gut, dass sich die Hochschulleitung nicht von der Hetzkampagne unterkriegen lässt. Das scheint ja heutzutage ein beliebtes Mittel in bestimmten Kreisen zu sein. Siehe Verfassungsgericht …
Jede politische Fragwürdigkeit bis hin zu üblen antisemitischen Stereotypen mit dem Verweis auf die „Kunstfreiheit“ rechtfertigen, und gleichzeitig „rechtliche Schritte“ gegen die Meinungsäußerung einer Initiative ankündigen. Genau mein Humor.
Zum antisemitischen Motiv: Die „nicht eindeutig lesbaren Motive“, die „in einem plastischen Prozess“ entstanden seien, sehen ganz zufällig aus wie ein Schwein? Also in einer politischen Arbeit, in der es – neben diversen anderen antiisraelischen Aktionen- um die Dämonisierung Israels geht, sieht das angeblich nicht „figurative“ Motiv rein zufällig aus, wie ein Schweinekopf? Leute… Was ist für euch gerade noch so antisemitisch? Ein Hakenkreuz?
Die „Judensau“ ist eindeutig Lingua tertia Imperia. Kritik an israelischer Politik in dieser Sprache ist antisemitisch. Die Proteste sind berechtigt und nötig. Künstler*innen ohne Geschichtskenntnisse und ohne Sprachempfindlichkeit sollten nicht ausgestellt werden. Die Burg muss dringend reagieren, distanzieren genügt nicht.
LTI ist die „Judensau“ eindeutig nicht. Die Wittenberger Stadtkirche ist schon ein wenig älter.
Der „Judenstern“ ist noch viel älter, hat aber sogar ein eigenes Kapitel in „LTI“.
Ihre Phantasie ist so grenzenlos wie das Universum.
Richtig so!
Was für Spinner spielen wieder Polizei?
So kann man Kunst auch kaputt machen…
Dirch Diffamierung des Betrachters?
Sorry, aber da muss der Professor mal einschreiten und stop sagen.
Das geht zu weit.
Pro Palästina geht gar nicht. Auch wenn’s nur nen Küchentuch ist, was um den Hals hängt.
Die Schule hatte mal einen gute Ruf, jetzt distanziert sie sich vom Hassstudenten? Nein. Steht gerade, nehmt es auf eure Kappe, Eltern haften für ihre Kinder.
Hass hat mit kunstfreiheit nichts zu tun.
Schmeißt die Rassisten raus.
Unglaublich. Nächstes Jahr meißelt ihr wieder Hakenkreuze in der Bildhauerei?
Jetzt handeln.
Danke
Und du kannst deine Thesen womit genau untermauern?
Mit Zement.
„Pro Palästina geht gar nicht. Auch wenn’s nur nen Küchentuch ist, was um den Hals hängt.“
Krass!
Ist das jetzt irgendwas mit „Unter-Menschen“? Oder warum darf man nicht für Palästinenser sein?
Die Studenten tragen bei der Modenschau ein Palästinenertuch, es kann als Modeschmuck und als politische Haltung gesehen werden, Angesichts des derzeitigen Gaza-Krieges ist es sicher Ausdruck einer Sympathie mit den Palästinensern:
„:Das Palästinensertuch (Kufiya) drückt häufig eine politische Haltung aus, insbesondere im Kontext des Nahost-Konflikts und der Solidarität mit den Palästinensern. Seine Bedeutung ist dabei sehr vielschichtig und hängt stark vom historischen Kontext und vom Selbstverständnis der Träger ab:
Symbol des Widerstands und der Solidarität: Ursprünglich diente die Kufiya als Erkennungszeichen des palästinensischen Widerstands und wurde vor allem durch palästinensische Vertreter wie Jassir Arafat weltweit als Symbol des palästinensischen Befreiungskampfes und der palästinensischen Identität etabliert
. In der linken Szene Europas, besonders seit den 1970ern, wurde das Tuch als Zeichen der Solidarität mit den Palästinensern und generell als Symbol für Aufstand, Freiheit und antiimperialistische Haltung getragen
.
Politische Kontroversen: Die Bedeutung kann stark polarisieren. Für viele Linke steht das Tuch für den Einsatz gegen Unterdrückung; konservative und rechte Stimmen interpretieren das Symbol hingegen oft als Zeichen für Antisemitismus und Ablehnung des Existenzrechts Israels, zumal es auch in rechtsextremen Kreisen aufgegriffen wurde
.
Modesymbol und Distanz zur Bedeutung: Phasenweise wurde das Palästinensertuch auch als Fashion-Statement getragen, ohne politisches Bewusstsein – insbesondere in den 2000ern, als es auf Laufstegen zu sehen war. Nicht alle Träger sind sich daher der politischen Bedeutung immer bewusst
.
Aktuelle politische Debatte: In jüngerer Zeit – insbesondere nach den Angriffen der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 – gilt das Tuch zunehmend als Symbol für Israel-Hass, Antisemitismus und Unterstützung der Hamas unter Kritikern
. Der öffentliche Umgang damit ist entsprechend kontrovers: Während einige Schulen oder politische Institutionen das Tragen untersagen, gibt es Stimmen, die das Tuch nicht pauschal als antisemitisches Symbol sehen
.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Das Palästinensertuch ist in vielen Zusammenhängen tatsächlich Ausdruck einer politischen Haltung. Es steht meist für Solidarität mit Palästina oder für den Protest gegen Israel, wird aber je nach Kontext auch als Zeichen von Widerstand, Antizionismus oder – von Kritikern – als antisemitisch gedeutet“