Sterben auf Wunsch: „Forschungsnetzwerk Suizidassistenz“ unter Federführung der Universitätsmedizin Halle nimmt Arbeit auf

In der Schweiz ist Sterbehilfe bereits seit Jahren etabliert. In Deutschland wird weiterhin diskutiert. Doch auch hier nehmen die Bitten zu. Verbunden ist das mit schwierigen Fragen. Welche Art von Aufklärung und Beratung sollen Menschen erhalten, die ihren Todeswunsch äußern, und unter welchen Voraussetzungen sollte eine Assistenz bei der Selbsttötung überhaupt erwogen werden? Zu diesen und weiteren Fragen will ein Forschungsnetzwerk unter Federführung der Universitätsmedizin Halle fundierte Handlungsoptionen aufzeigen.
Ziel sei es, Brücken zwischen den verschiedenen Akteuren zu bauen, sagt Prof. Dr. Jan Schildmann, Sprecher des Forschungsnetzwerks Suizidassistenz und Direktor des Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin an der Universitätsmedizin Halle. Mit Blick auf die Erfahrungswerte aus der Schweiz geht er von jährlich 20.000 Fällen aus. Zwei Prozent der Sterbefälle in der Schweiz gehen auf assistierten Suizid zurück „Die Anfragen werden natürlich un ein vielfaches höher sein.“ Man wolle für das Forschungsnetzwerk alle Bereiche an einen Tisch holen, sowohl Praxis, als auch Wissenschaft. Das Netzwerk besteht aus 16 Mitgliedern. Schildmann selbst befasst sich schon seit einigen Jahren mit dem Thema, was auch ein Grund war, die Federführung für das Projekt in Halle anzusiedeln.
„Die Assistenz zur Selbsttötung ist angesichts der Tragweite für die Betroffenen, ihre Angehörigen, aber auch für die Gesellschaft ein kontrovers diskutiertes Thema, das tiefgreifende ethische und darüber hinaus gehende Fragen aufwirft. Bislang fehlt es weitgehend an wissenschaftlich gestützten Verfahren, wie mit Anfragen nach Suizidassistenz, die in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen und aus sehr verschiedenen Motiven entstehen, verantwortungsvoll umgegangen werden kann“, so Schildmann.
Drängende Fragen aus der Praxis
Es stellen sich drängende Fragen nach den Aufgaben, die Angehörige der Gesundheitsberufe dabei übernehmen und welche Rollen sie explizit nicht einnehmen sollen. Welche Informationen brauchen Menschen, die einen assistierten Suizid in Erwägung ziehen, und wie kann sichergestellt werden, dass sie ausreichend über andere Möglichkeiten informiert sind? Wie kann man feststellen, ob eine Person wirklich in der Lage ist, eine solche Entscheidung selbstbestimmt und eigenverantwortlich zu treffen? Welche Standards sollten für Aufklärungs- und Beratungsgespräche gelten und wie sollten diese Gespräche dokumentiert werden?
„Der häufig stark gemachte Gegensatz von Suizidprävention und Suizidassistenz verhindert eine konstruktive Diskussion über einen verantwortbaren Umgang mit den vielschichtigen Anfragen nach Suizidassistenz. Im Ringen um eine angemessene Praxis ist es wichtig, dass wir Menschen aus unterschiedlichen Berufen und mit verschiedenen Perspektiven und Positionen zusammenbringen. Deshalb freue ich mich, dass wir jetzt mit renommierten Wissenschaftler:innen aus Deutschland sowie weiteren Gästen aus dem In- und Ausland die Arbeit im Netzwerk aufnehmen können“, so der Internist und Medizinethiker Schildmann.
Die Arbeit im wissenschaftlichen Netzwerk knüpft an eine Reihe aktueller bundesweiter Initiativen zu diesem Thema an. Dazu gehört eine laufende Analyse, für die in Zusammenarbeit mit mehreren Landesärztekammern im Sommer dieses Jahres Daten zur aktuellen Handlungspraxis am Lebensende erhoben wurden. Die Daten werden einer mit gleicher Methode durchgeführten Studie von 2013 gegenübergestellt, so dass erstmals für Deutschland Entwicklungen nachgezeichnet werden können. Darüber hinaus ist jüngst der Startschuss für die Entwicklung einer nationalen Leitlinie für Angehörige verschiedener Gesundheitsberufe gefallen, die demnächst auch von einem Online-Berichts- und Lernsystem über die Erfahrungen in der Praxis begleitet werden soll. Fortbildungen zum Thema sowie die geplante Vernetzung von Akteuren aus der Praxis der Suizidprävention, Pflege, Palliativversorgung und Suizidassistenz in Sachsen-Anhalt ergänzen die wissenschaftliche Arbeit.
Neben Prof. Dr. Jan Schildmann als Sprecher und Leiter des Netzwerks sind Prof. Dr. Gabriele Meyer (Institut für Gesundheits- und Pflegewissenschaften, Universitätsmedizin Halle), Prof. Dr. Claudia Bozzaro (Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin, Universität Münster) und Dr. Jakov Gather (Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Präventivmedizin, LWL-Universitätsklinikum, Ruhr-Universität Bochum) koordinierende Mitglieder des Forschungsnetzwerks Suizidassistenz.
Weitere Informationen zum Netzwerk sind online verfügbar unter www.forschungsnetzwerk-suizidassistenz.de.
Das Vorhaben wird durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert.
Hintergrund
2023 berichteten Sterbehilfeorganisationen über knapp 900 Fälle, die tatsächliche Anzahl liegt allerdings womöglich deutlich höher. Der Anstieg steht im Zusammenhang mit einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2020, wonach freiverantwortlich handelnde Menschen die rechtliche Möglichkeit haben, Hilfe bei der Selbsttötung in Anspruch zu nehmen.




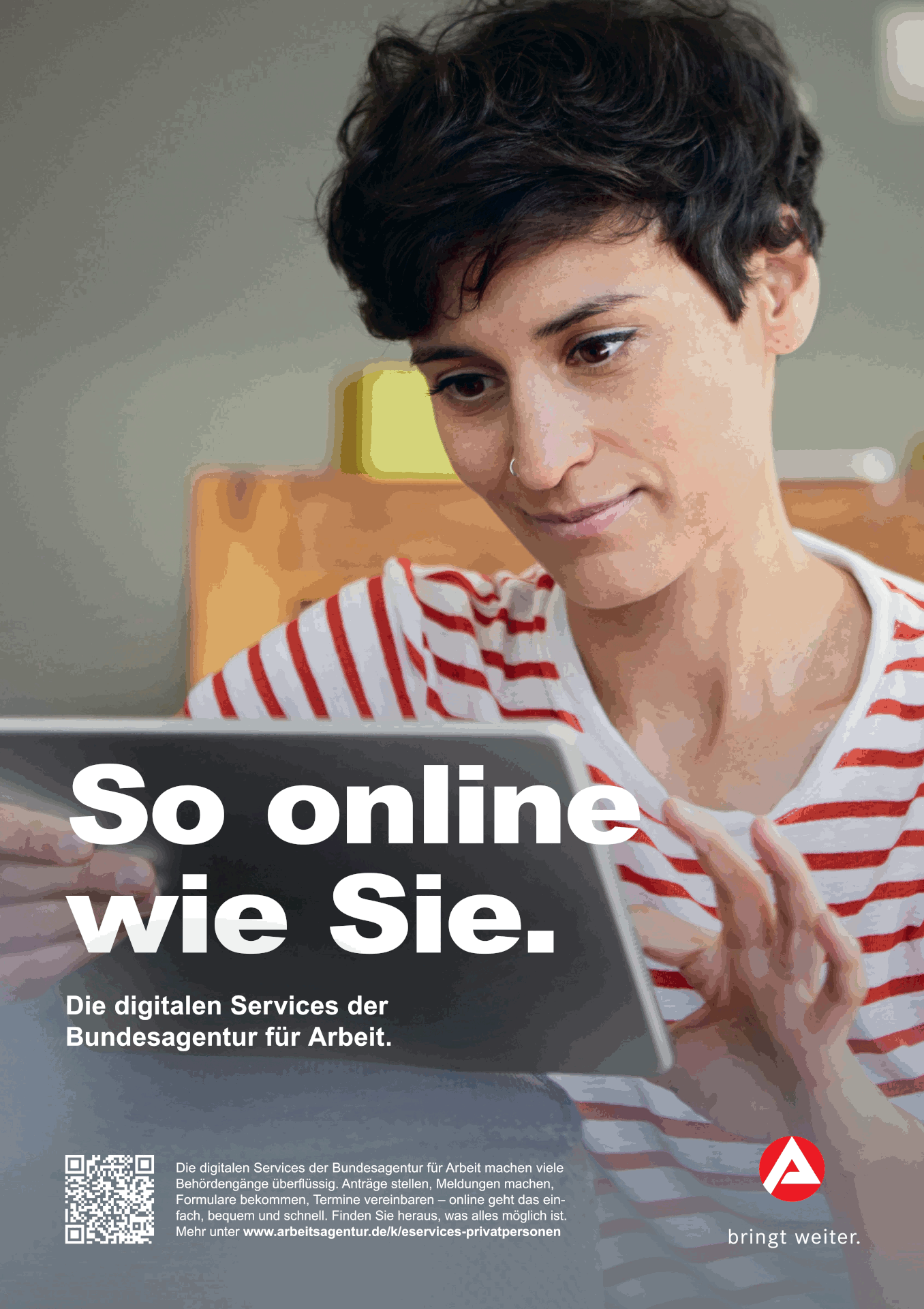







Jeder soll über sein eigenes Leben bestimmen können und nicht irgendein anderer außer Gott. Wer sterben will, soll’s auch machen.
Werter Detlef.
Wenn ich mir deinen Kommentar so durchlese, komme ich zu dem Schluss, dass 17:48 Uhr noch nicht deine Zeit gekommen war.
Oder Gott betrat während des ersten Satzes gerade deine Bude und du warst dir beim Zweiten schon wieder sicher, dass er weg ist.
Außer dummes Gelaber über andere Teilnehmer kannst du nichts. Was soll das?
Mein Gott, Jürgen!
Lies dir den ersten Kommi nochmal durch.
lol
Schlimm, dass in Deutschland aktive Sterbehilfe immer noch nicht möglich ist und man auf andere Länder ausweichen muss, wo das möglich ist. Wir hinken mit allem hinterher. Es ist einfach nur frustrierend. Nicht mal sterben kann man, wann man will. Da bleibt nur noch Selbstmord.
Das musste den Parlamentariern des Bundestags verdanken, die erst mal dagegen gestimmt haben.
Ich persönlich lasse mir von Pappnasen nicht vorschreiben wenn ich den Pfiff mache. Das geht diesen Schwurblern einen D…. an.
Du kannst den Pfiff machen wann du willst – musst es halt nur alleine hinkriegen.
So erfreulich es ist, dass sich auf diesem Gebiet endlich was tut – warum das Rad neu erfinden? Warum nicht auf die Erfahrungen der Schweiz und der Niederlande zurückgreifen?
@Miraculix
Wie kommst du zu der fragwürdigen Auffassung, das im Artikel genannte Forschungsnetzwerk würde nicht auch Erfahrungen anderer Länder in die Untersuchungen einbeziehen?
Das Maß aller Dinge in Sachen Moral, Ethik, Sterbehilfe ist eben Deutschland. Es wird, wenn überhaupt, wieder einen sehr komplizierten, bürokratischen und nur schlecht umsetzbaren deutschen Sonderweg geben.
Wann endlich kommt das denn?