Zahl der Wölfe in Sachsen-Anhalt auf 232 gestiegen: Umweltminister kündigt Erlass für Schnellabschüsse

Der Wolf breitet sich in Sachsen-Anhalt weiter aus. Das geht aus dem aktuellen Monitoringbericht des Landesamtes für Umweltschutz (LAU) hervor, den Umweltminister Prof. Dr. Armin Willingmann gemeinsam mit LAU-Präsidentin Dr. Sandra Hagel heute in Magdeburg vorgestellt hat. So ist die Zahl der im Land lebenden Wölfe auf 258 gestiegen. Auch wurde im Berichtszeitraum von Mai 2023 bis April 2024 ein leichter Anstieg der Übergriffe auf Nutztiere registriert. Umweltminister Willingmann kündigte am Montag einen Erlass für so genannte „Schnellabschüsse“ in Sachsen-Anhalt an. Dieser sieht vor, dass Wölfe, die wiederholt an Nutztierrissen beteiligt waren, in Regionen mit erhöhtem Rissaufkommen künftig bereits nach dem erstmaligen Überwinden des zumutbaren Herdenschutzes unbürokratischer entnommen werden dürfen.
„Der Wolf ist in Sachsen-Anhalt wieder heimisch geworden. Das ist aus Sicht des Natur- und Artenschutzes ein Erfolg. Angesichts der wachsenden Population im Lande halte ich es für notwendig, noch mehr für ein konfliktarmes Leben mit dem Wolf zu tun“, betonte Willingmann. „Mit dem Erlass schaffen wir die Möglichkeit, Wölfe mit auffälligem Verhalten künftig unbürokratischer entnehmen zu können. Wir knüpfen hier an das im Bundesumweltministerium entwickelte Modell der so genannten Schnellabschüsse an, das auf der Umweltministerkonferenz im Dezember 2023 vorgestellt und seitdem in den Ländern weiterentwickelt wurde. Klar ist aber auch: Ohne Änderung des Rechtsrahmens auf Europa- und Bundesebene wird es weiterhin keine gezielte Bestandsregulierung mittels systematischer Entnahmen geben. Wir werden darüber hinaus auch die Tierhalter nicht aus der Verantwortung entlassen, konsequent wolfsabweisenden Herdenschutz einzusetzen.“
Der Erlass zum Umgang mit dem Wolf sieht vor, dass das Landesamt für Umweltschutz prüft, ob ein Gebiet mit erhöhtem problematischen Nutztierrissaufkommen festlegt werden kann. In diesen Gebieten ist die Entnahme eines Wolfs bereits nach erstmaligem Überwinden eines zumutbaren Herdenschutzes und dem Riss von Weidetieren binnen 21 Tagen nach dem Übergriff möglich. Die Entnahme darf dann im Umkreis von 1.000 Metern erfolgen. Das entsprechende Gebiet wird vom LAU festgelegt, die Ausnahmegenehmigung vom Landesverwaltungsamt erteilt. Eine genetische Individualisierung des schadenstiftenden Wolfs vor der Abschussgenehmigung ist für eine Entnahme dann nicht erforderlich.
Erlass wird Gerichtsentscheidungen aus Niedersachsen berücksichtigen
Der Erlass berücksichtigt die Entscheidung des Niedersächsischen Oberverwaltungsgerichtes vom 12. April 2024 (Az. 4 ME 73/24). Auch in Gebieten mit erhöhtem Nutztierrissaufkommen wird es nicht zu automatischen Entnahmen von Wölfen kommen. In jedem Einzelfall ist zu prüfen, ob ein ernster wirtschaftlicher Schaden droht. Eine Entnahme wird zudem nur dann möglich, wenn durch den Wolf der zumutbare Herdenschutz überwunden wurde. Maßgeblich für den zumutbaren Herdenschutz ist der Praxisleitfaden zur Erteilung artenschutzrechtlicher Ausnahmen, den Bund und Länder erstellt haben. Veröffentlicht werden soll der Erlass zu Schnellabschüssen noch im Dezember.
Zahl der Wolfsrudel steigt auf 32
Zwischen Mai 2023 und April 2024 ist die Zahl der in Sachsen-Anhalt lebenden Wölfe um 54 auf insgesamt 258 gestiegen. 78 von ihnen sind erwachsene Wölfe, 40 sind so genannte Jährlinge und bei 129 handelt es sich um Welpen. 11 weitere konnten nicht zweifelsfrei zugeordnet werden. Zu den 258 Wölfen kommen noch 34 Tiere hinzu, die sich in grenzübergreifenden Territorien bewegen. Die Zahl der im Land lebenden Wolfsrudel nahm von 27 auf 32 zu, die Zahl der Welpen pro Rudel stagnierte bei 3,6. Nachdem die Zahl der Übergriffe von Wölfen auf Nutztiere mit 59 im vorherigen Berichtszeitraum auf den niedrigsten Stand seit 2018 fiel, ist im aktuellen Monitoring wieder ein leichter Zuwachs an Rissvorfällen auf 63 zu verzeichnen. Auch wurden wieder mehr Tiere getötet, die Zahl stieg von 176 auf 228.
Fehlender Herdenschutz häufig ein Grund für Rissvorfälle
Regional waren die Übergriffe durch Wölfe auf Nutztiere sehr unterschiedlich verteilt. Die meisten Rissvorfälle wurden im Altmarkkreis Salzwedel (28,6 Prozent) gemeldet, gefolgt vom Landkreis Jerichower Land (23,8 Prozent) und dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld (14,3 Prozent). Dort gab es jedoch nicht die meisten bekannten Wolfsrudel. Diese waren im Landkreis Wittenberg zu finden. Trotz größerer Population wurden hier aber nur 9,5 Prozent aller Übergriffe auf Nutztiere registriert. Insoweit korrespondierte das Rissgeschehen eher mit der Einhaltung wolfsabweisender Herdenschutzmaßnahmen. Weiterhin nur wenig verbreitet ist Herdenschutz beispielsweise bei Hobbyhaltern – in 83 Prozent der Fälle war der Herdenschutz unzureichend.
6.000 Hinweise für Monitoringbericht ausgewertet
Für den Monitoringbericht ist eine breite Datengrundlage von großer Bedeutung. Hinweise oder Sichtungen können über das Tierartenmeldeportal direkt online an das Wolfskompetenzzentrum Iden (WZI) gemeldet werden. Dazu erklärte LAU-Präsidentin Hagel: „Für den aktuellen Monitoringbericht wurden fast 6.000 Hinweise ausgewertet, viele davon stammen aus Forstbetrieben, der Jägerschaft oder kommen direkt aus der Bevölkerung. Um die Meldung möglichst einfach zu machen, haben wir das Formular für Wolfshinweise jetzt neu in unser Tierartenmonitoring-Portal für Sachsen-Anhalt aufgenommen und für Mobiltelefone optimiert.“
Der aktuelle Wolfsmonitoringbericht sowie die Berichte der Vorjahre können auf den Internetseiten des Landesamtes für Umweltschutz heruntergeladen werden: https://lau.sachsen-anhalt.de/publikationen/berichte-und-fachinformationen/wolfsmonitoringberichte



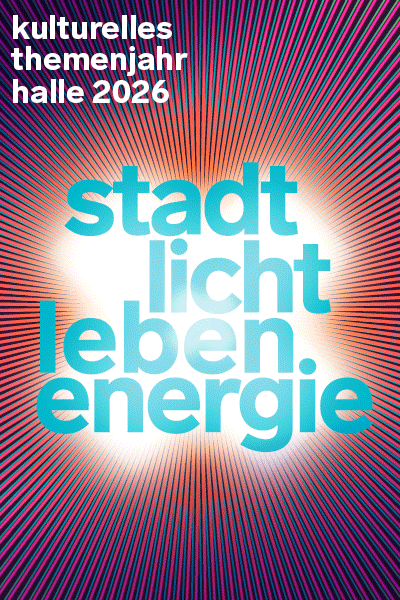


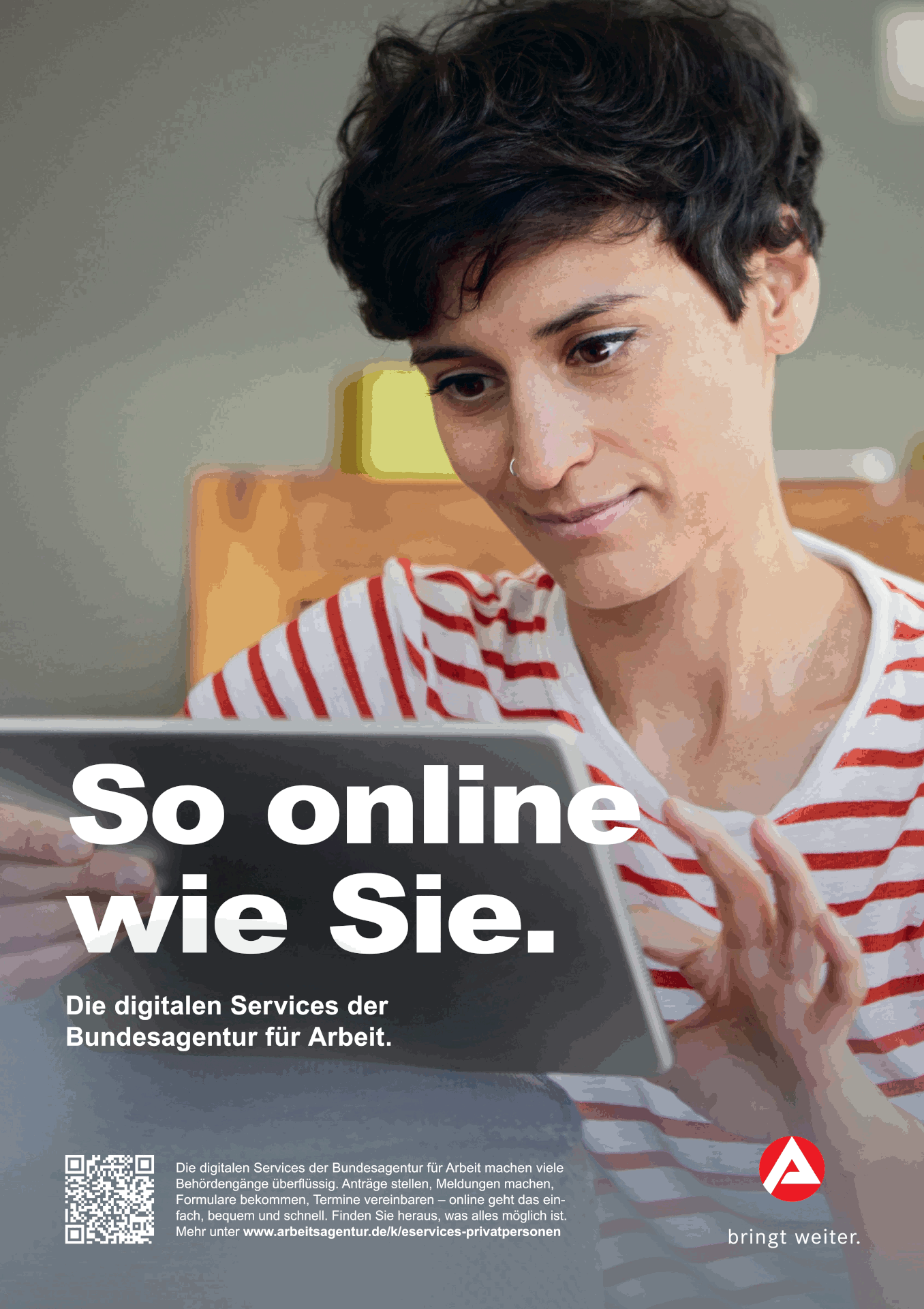




„Entnahme“ … was für eine bürokratische Umschreibung des Töten. Wenn man schon regulierend eingreifen muss, dann bitte auch offen dazu stehen. Oder entnimmt Putin auch gerade in der Ukraine Soldaten und Zivilisten?
Die Zahl der Menschen im Lebensraum der Wölfe hat sich in den letzten Jahrzehnten vervielfacht. Wann gibt es die Abschusserlaubnis?
Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun?
Was kann denn bitte der Wolf dafür?
Bis das erste Rotkäppchen gerissen und die erste Großmutter gefressen wurde. Sich dann aber aufregen, wenn man den Bauch des Wolfes mit Wackersteinen füllt und ihn in den Brunnen fallen lässt…
Lächerliche 200+ Wölfe und schon wird der Abschuss erleichtert. Wer hat Angst vorm bösem Wolf? Der subventionsverwöhnte Bauer, unsere größten Biodiversitätsvernichter! Sonst keiner.
Der „normale“ Bauer interessiert sich überhaupt nicht für Wölfe. Nur diejenigen die im Auftrag des Umweltschutzes mit Schafen und Rinder Grünland beweisen um die Biodiversität zu erhalten. Nur die sind ja überhaupt betroffen. Sie sollten anfangen etwas zu differenzieren und etwas über solche Realitäten zu lernen. Ansonsten würde man denken, das sie nichts über diese Dinge wissen außer Plattheiten und Vorurteile. Und sich dann wundern wenn die Bauern genug von ideologischen Stadtbewohner wie Ihnen haben und mal ihre Traktoren irgendwo „abstellen“.
Gerade die Landwirte ohne Tierzucht sind Hauptvernichter der Biodiversität. Aber was Hänschen nicht weiß, weiß Hans erst recht nicht. Verabdchiede Dich mal von der Mär, die Bauernverband und Lebensmittelwerbung so betreiben. Und ja, Schafbeweidung ist eine der wenigen bäuerlichen Tätigkeiten die gut sind für die Biodiversität. Und wenn der Wolf da ein paar Schafe reißt, es kommen neue nach zu Ostern. Gibt es eben eins weniger fürs Opferfest. Die Wildbiologie hat zudem gezeigt, dass der Wolf positiv auf den Wildbestand wirkt, gesünder und nimmt nicht ab. Wie auch, sonst wären die Bestände ja schon vor dem Menschen ausgerottet gewesen. Seltsam, dass die alle Jahrtausende mit Wolf und ohne dessen Abschuss überlebt haben ….
Vorgestern habe ich noch gelesen, das gerade die Tierhaltung schlecht ist, wegen Klima und so. Die Rinder pupsen zu viel. Ernsthaft, die Forderungen an Landwirte sind wirr, der Eine will dies, der andere das. Der eine will keine Rinder wegen Klima ( dann auch kein biodiverses Grünland – wozu ohne Grasfresser?) Die anderen wollen Blühstreifen für die Bienchen. Nur Getreideanbau zum Essen braucht offensichtlich niemand. Beim Bäcker gibt’s ja sowieso immer 25 Brotsorten. Ebenso ist Bulgur immer im Laden da. Dann sollen Schafe in Naturschutzgebieten die Landschaft vor dem verwalden (Wald ist aber Klimaschutz!) retten. Die Wolle braucht niemand, Hammel isst auch keiner (außer dem Wolf). Die Schafzüchter sollen gefälligst 365 Tage im Jahr die Tiere versorgen. Und die Klappe halten wenn der Stadtbewohner Wölfe niedlich findet. Zu früher: da gab es nicht 80 Millionen Menschen auf so engem Raum. Zu den Wölfen: Ich habe nichts gegen Wölfe, aber auch hier gilt: Leben und leben lassen, die Möglichkeit die Bestände zu regulieren ist gut. Oder glauben sie ernsthaft, das Wölfe die schon öfter in Schafherden waren das lassen? Ich höre gleich: Zäune, Herdenschutzhunde usw. . So einfach ist das nicht. Auf Felsen geht der Zaun nicht rein, und der Hund beißt auch. Gerade die felsigen Trockenrasen sollen die Schäfer aber beweiden. Der Hund ist groß und kampfstark, damit potentiell und praktisch auch ein Risiko, wie sollte er sonst bestehen gegen einen Wolf. Das sind keine Kuscheltiere nach dem sie aussehen.
Wenn das Vieh nicht auf die Weide kann, dann wird nicht etwa weniger Vieh gehalten, sondern es kommt in den Stall. Das bringt dem Klima eher nichts.
Das ist ein Trugschluss. Rinder haben im Pansen Bakterien um Gras verdauen zu können. Diese Vorverdauung (Vergärung ) setzt das klimaschädliche Methan frei. Kühe in Stallhaltung mit Konzentrat Fütterung, also mit weniger Grünanteil setzen wesentlich weniger Methan frei als Rinder auf der Weide. Die Welt ist kompliziert. Nur wenn man wenig weiß, dann ist alles einfach. Nebenbei braucht man bei Stallhaltung weniger Kühe um den Milchbedarf zu decken. Oder eben kein Käse, Joghurt, High Protein Produkte, Sahne, Schmand……. Babynahrung.
https://www.agrarheute.com/tier/rind/weidehaltung-gut-fuers-klima-564269
Milchvieh auf der Weide? Wo gibt es das noch in relevanten Mengen. Das hat auch andere Gründe. Milchvieh steht, wenn überhaupt, nur sehr Stallnah auf der Weide, das hängt mit der Melkanlagen und der vorgeschriebenen Kühlung zusammen. Theoretische Rechnungen an der Universität halte nicht immer einen Praxistest stand. Ausnahmen gibt es, aber seit 20 Jahren sind selbst in den Alpen praktisch nur Trockensteher und Färsen auf den Hängen.
„Relativ viele Kühe mit Weidegang wurden in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein erfasst. Hier standen 74 Prozent der Milchkühe auf der Weide.“
https://milchindustrie.de/milkipedia/haltungsformen-von-kuehen/
Zitat aus der Studie: nur 1% der meist kleinen Betriebe gab an… .usw. Das bedeutet genau meine Aussage. Nur Trockensteher stehen draußen. Innerhalb der Laktation, das sind meist 8 Monate im Jahr, haben diese Tiere nur wenig Auslauf. Die Formulierungen im Text sind clever, sagen aber nichts anderes aus als ich oben. Nur die Interpretation der Texte ist bei ihnen so angekommen wie beabsichtigt. Die 74% bedeutet im Klartext: 28 % ganzjährige Stallhaltung, der Rest darf als Trockensteher auf die Weide, meist 24 h weil die dadurch weniger Arbeit machen. Aber nur für 3-4 Monate im Jahr. Innerhalb der Laktation maximal Stallnah, auf den Flächen steht aber kein Bewuchs mehr wegen der hohen Tierdichte. Ob man das Weide nennen kann? Bei einer Befragung mal so mal so. Fahren sie doch einfach mal in der Gegend rum und suchen sie Weidemelkstände, die gab es früher oft. Heute nicht mehr, wenn dann nur sehr klein. Ursache ist unsere Hygiene(wahn)vorschrift.
Eine Entnahme per Drohne würde das Verfahren deutlich vereinfachen. Moderne Drohnen verfügen über IR/UV-Sensorik und können mit entsprechenden letalen Wirkmitteln versehen werden.
Entnahme? Du meinst Abschuss. So wie die Russendrohnen in der Ukraine beim Menschen …. Da könnte man Sie dann aber auch zum nicht-letalen Herdenschtz einsetzen, so als Hütehund 2.0.