Heftige Debatte im Stadtrat um fehlende Akten zum Moschee-Bau in Halle-Neustadt und Kritik an OB Vogt

Seit dieser Woche rollen die Bagger am Meeresbrunnen in Halle-Neustadt, das neue Islamische Kulturcenter (IKC), oft auch als Moschee bezeichnet, wird gebaut. Doch das interne Verwaltungsverfahren sorgt weiterhin für heftige Debatten. Das zeigte sich am Mittwoch im halleschen Stadtrat. Denn normalerweise verläuft in Kommunen eine Baugenehmigung unspektakulär und weitgehend abseits öffentlicher Aufmerksamkeit. Auch in Halle-Neustadt schien das Bauvorhaben des Islamischen Kulturcenters (IKC) zunächst ein solcher Vorgang zu sein. Die muslimische Gemeinde plante eine neue Einrichtung, bestehend aus Gebetsräumen, Veranstaltungsflächen und Bildungsangeboten. Doch mit Amtsantritt von Oberbürgermeister Dr. Alexander Vogt geriet die Genehmigung ins Stocken. Vogt hatte sich im Wahlkampf gegen den Standort des IKC Mitten im Wohngebiet positioniert und einen Standort am Stadtrand favorisiert. Die Bauakte bewegte sich nicht vorwärts, Gespräche blieben ergebnislos, und Fragen nach der Dauer der Bearbeitung wurden immer drängender.Die Islamische Gemeinde beklagte sich öffentlich über den Verzug. Weil im Zuge dessen der Verdacht aufkam, OB Vogt könnte die Baugenehmigung bewusst verzögern oder gar rechtswidrig zurückhalten, erreichte die Angelegenheit eine neue Ebene politischer Brisanz. Für Verwaltungsvorgänge dieser Art existieren klare Fristen und Vorgaben. Dass Ratsmitglieder öffentlich äußerten, es könne auf der Führungsebene Unregelmäßigkeiten geben, war ein außergewöhnlicher Schritt. Besonders irritierte: Die Verwaltung hatte sich auf Nachfragen mehrfach widersprüchlich geäußert. Um endlich Klarheit zu gewinnen, beantragten mehrere Fraktionen des Stadtrates Akteneinsicht. Es hätte der Moment sein können, an dem sich die Vorwürfe als unbegründet herausstellten und Vertrauen wiederhergestellt worden wäre. Genau das Gegenteil geschah. Die Akteneinsicht entwickelte sich zum Ausgangspunkt einer Affäre, die das Verhältnis zwischen Verwaltungsspitze und Stadtrat nachhaltig beschädigte.
Entschuldigungsschreiben verstärkt Widersprüche
Die gewährte Akteneinsicht brachte die erste Überraschung: Die vorgelegten Unterlagen enthielten Lücken. Nicht nur einzelne Dokumente fehlten, sondern ganze Zeiträume von zwei Monaten. Ratsmitglieder, die sich anschließend miteinander austauschten, stellten fest, dass zentrale Schriftwechsel zwischen dem OB-Büro und Geschäftsbereichen nicht vorhanden waren. Dies führte zu einer sofortigen Beschwerde an den Oberbürgermeister. Wenige Tage später erhielten alle Stadträtinnen und Stadträte ein umfangreicheres Schreiben aus dem OB-Büro, das als Entschuldigung gedacht war – und sich zur Eskalation entwickelte. Darin schilderte Vogt, der „vorgelegte Aktenordner“ sei „dünn“ gewesen und habe „offensichtlich nicht den vollständigen internen Schriftverkehr“ umfasst. Besonders fehlten Unterlagen aus Geschäftsbereich 3, der für die Baulasteintragung und den Grundstücksverkauf zuständig ist. Dieser Satz löste bei mehreren Ratsmitgliedern Verwunderung aus. Denn die Formulierung machte klar: Ein Aktenordner muss dem Oberbürgermeister vorgelegen haben. Doch: Diesen Ordner hatte niemand im Stadtrat gesehen. Die Akteneinsicht, zu der der Stadtrat eingeladen worden war, enthielt ihn nicht. Mit diesem Widerspruch blieb die Situation nicht nur ungeklärt – sie wurde unverständlicher als zuvor. Wollte die Verwaltung unvollständige Akten nicht zeigen? War die interne Weitergabe zwischen Geschäftsbereichen gestört? Hatte das OB-Büro eine Vorauswahl getroffen? Oder war es – weniger spektakulär, aber ebenso folgenreich – eine Verkettung organisatorischer Versäumnisse? Der Stadtrat erwartete Antworten. Doch die Art, wie diese in der folgenden Sitzung ausblieben, sollte die Affäre erst richtig entfachen.
Debatte in der Fragestunde
Zum Ende der Stadtratssitzung am Mittwoch wurde es dann hitzig. Denn unter dem Punkt Anfragen haben sich Katja Müller (Linke), Eric Eigendorf (SPD) und Ferdinand Raabe (Volt) zu Wort gemeldet und OB Vogt kritisiert. Es folgten auch mehrere Zwischenrufe von FDP und AfD, die sich über das beharrliche Nachfragen beschwerten – immerhin glich das Vorgehen fast einem Verhör. Gerade die AfD hat sich ja in der Vergangenheit mehrfach gegen den Moschee-Bau in Neustadt geäußert.
Katja Müller erinnerte daran, dass die Information über die unvollständige Akte inzwischen öffentlich geworden war und dass das Entschuldigungsschreiben selbst den Eindruck eines Widerspruchs erzeuge. Ihre zentrale Frage lautete: Wenn es einen „dünnen Ordner“ gegeben habe, der nicht vollständig gewesen sei, warum sei dieser Ordner den Stadträten nicht vorgelegt worden? Sie formulierte es mehrfach in variierenden Schärfegraden und drängte auf eine klare Antwort. Vogts Reaktion war knapper als erwartet. Er betrachte die Angelegenheit nicht als widersprüchlich, erklärte er, und sehe seine Stellungnahme als abgeschlossen an. Dies erzeugte sichtbare Irritation. Müller präzisierte ihre Frage erneut und wies darauf hin, dass der OB von sich aus die Unvollständigkeit des Ordners thematisiert habe. Wenn dieser Ordner existierte, sei die Frage, warum er dem Stadtrat nicht vorlag, unvermeidlich. Als Vogt erneut auf sein vorhandenes Schreiben verwies, wurde Müller deutlicher und sagte: „Veralbern müssen Sie uns nicht.“ Es sei die Aufgabe des Oberbürgermeisters, nachvollziehbar zu kommunizieren, und nicht, auf ein Schreiben zu verweisen, das erst neue Fragen aufwerfe.
Der Oberbürgermeister reagierte zunehmend gereizt. Er betonte mehrfach, er habe alle Akten angefordert, aber die Verwaltung habe ihm nicht alles vollständig geliefert. Dies sei erst am Freitag – zwei Tage vor der Akteneinsicht – aufgefallen. Eine rechtzeitige Kommunikation sei bedauerlicherweise unterblieben. Aus seiner Sicht lag damit eine interne Panne vor, keine bewusste Zurückhaltung. Gleichzeitig weigerte er sich, einzelne Geschäftsbereiche zu benennen, die verspätet oder unvollständig geliefert hätten. Er erklärte dies als Loyalitätsfrage: Er trage die Verantwortung für die Verwaltung als Ganzes. Der Eindruck eines ausweichenden Antwortstils verfestigte sich jedoch. Selbst einfache Ja- oder Nein-Fragen beantwortete Vogt nicht direkt, sondern wiederholte Passagen aus seinem Schreiben. Für die Ratsmitglieder, die auf eine klare Erklärung gehofft hatten, wurde damit das Gefühl verstärkt, dass nicht vollständig offen kommuniziert werde.
Die Debatte machte sichtbar, dass der eigentliche Konflikt nicht in der Frage lag, welche Unterlagen gefehlt hatten, sondern warum der Stadtrat darüber nicht informiert worden war. Die Stadtordnung von Halle sieht ausdrücklich vor, dass Akteneinsicht vollständig und unverzüglich gewährt werden muss. Wenn dies aus organisatorischen Gründen nicht möglich ist, sind die Antragstellenden darüber zu informieren. Das war nicht geschehen. Für Ratsmitglieder wie Eric Eigendorf ist dies mehr als ein technischer Fehler: Es ist ein Bruch des grundlegenden Vertrauens in die Zusammenarbeit zwischen Stadtrat und Verwaltungsspitze. Eigendorf beschreibt Akteneinsicht als einen „wesentlichen Punkt in der Arbeit des Stadtrats, um Sachverhalte tiefer zu durchdringen“. Dass der Stadtrat erst durch die Presse Hinweise erhielt, dass überhaupt ein weiterer Ordner existiere, verstärkte die Irritation zusätzlich. Die Kommunikation verlief so unklar und fragmentiert, dass die Fraktionen sich nicht sicher sein konnten, ob sie tatsächlich das gesamte Material erhalten hatten – oder erst auf Nachfrage erhalten würden. Dieser Vertrauensverlust ist wesentlich, denn ohne funktionierendes Zusammenspiel zwischen Rat und Verwaltung kann keine Kommune effektiv handeln. Das IKC-Verfahren wurde damit zum Symptom eines tieferen Problems: der Frage, wie transparent die Verwaltung arbeitet und wie ernst der Oberbürgermeister die Kontrollfunktion des Stadtrats nimmt.
Strukturen, Zuständigkeiten und offene Widersprüche
In der erweiterten Debatte wurde zunehmend deutlich, dass sich hinter der Frage nach dem fehlenden Ordner eine strukturelle Komplexität verbirgt, die nur schwer zu durchschauen ist. Die Verwaltung Halles ist in mehrere Geschäftsbereiche gegliedert, die unterschiedliche Rollen in Bau- und Grundstücksangelegenheiten haben. Geschäftsbereich 2 ist für Bauwesen zuständig, Geschäftsbereich 3 für Liegenschaften und die Vorbereitung von Grundstücksverkäufen. Das OB-Büro wiederum koordiniert und sichtet die Unterlagen, bevor sie an den Stadtrat gehen. Genau an diesen Schnittstellen scheint der Vorgang ins Wanken geraten zu sein. Müllers Hinweis auf Aussagen aus Geschäftsbereich 2, wo man erklärt hatte, alles vollständig geliefert zu haben, stellte den Oberbürgermeister vor ein Problem. Seine Darstellung einer verspäteten oder unvollständigen Lieferung widersprach dem, was im Hauptausschuss festgehalten worden war. Ob es sich um ein Missverständnis, ein Kommunikationsdefizit oder unterschiedliche Vorstellungen von Vollständigkeit handelte, blieb offen – doch die Widersprüche standen nun im Raum. Die Nachfragen zu Grundstücksverkäufen – unter anderem, wer über Verkäufe der Größenordnung des IKC-Grundstücks entscheidet – vertieften die Diskussion über Verantwortlichkeiten weiter. Die Antwort der Verwaltung, Grundstücksverkäufe unter der Wertgrenze würden im Regelfall von Geschäftsbereich 3 entschieden, war technisch richtig, aber ließ offen, welche Rolle das OB-Büro bei der politischen Steuerung solcher Vorgänge spielt. Dass Vogt auf konkrete Nachfragen nach Stichtagen keine Angaben machen wollte und auf die „umfangreiche Akteneinsicht“ verwies, wirkte wie ein Ausweichen.
E-Mail-Verkehr und die Rolle der Presse
Ferdinand Raabe brachte schließlich einen Aspekt ins Spiel, der die Debatte inhaltlich verbreiterte: den E-Mail-Verkehr zwischen OB-Büro und Geschäftsbereich 2. Die Mitteldeutsche Zeitung hatte berichtet, dass genau dieser Schriftwechsel im fehlenden Ordner enthalten sein könnte. Sollte das zutreffen, wäre die Brisanz erheblich, denn interne Abstimmungen zwischen Verwaltungsspitze und Geschäftsbereichen gehören zu den wichtigsten Dokumenten bei der Frage, wie Entscheidungen vorbereitet oder verzögert wurden. Raabe wollte wissen, ob dieser Mailverkehr tatsächlich die Hauptlücke darstellte und ob – selbst wenn der Ordner aus GB2 nicht vorgelegen habe – der gleiche Mailverkehr nicht wenigstens im OB-Büro vollständig vorhanden gewesen sein müsse. Vogts Antwort blieb unklar. Er verwies darauf, dass „genau dies geprüft“ werde, und kritisierte die Genauigkeit der Presseberichterstattung, ohne jedoch die Frage zu beantworten. So habe die Mitteldeutsche Zeitung geschrieben, er habe den Weihnachtsmarkt mit dem Landrat aus dem Saalekreis, Hermut Handschak, eröffnet. Allerdings war der Landtagsabgeordnete Sven Czekalla da. „Deswegen würde ich jetzt nicht unbedingt immer auf die Aussagen der Mitteldeutschen Zeitung vertrauen“, meinte Vogt. Die Ratsmitglieder mussten die Sitzung mit der Erkenntnis verlassen, dass der entscheidende Punkt, der Licht in die Abläufe bringen könnte, weiterhin ungeklärt war. Müller beantragte Wortprotokoll.
Wie ein Verwaltungsproblem zu einem politischen Konflikt wurde
Die Affäre um die Akteneinsicht zum IKC verdeutlicht mehrere Merkmale kommunalpolitischer Dynamik, die einzeln harmlos sein mögen, in ihrer Kombination aber explosive Wirkung entfalten. Verwaltungstechnisch begann alles vermutlich mit einer organisatorischen Fehlstelle: Unterlagen wurden verspätet geliefert oder unvollständig zusammengestellt. Solche Vorgänge sind nicht ungewöhnlich, da Dokumente aus verschiedenen Geschäftsbereichen zugesandt, sortiert und geprüft werden müssen. Dass jedoch niemand rechtzeitig den Stadtrat informierte, war der entscheidende Fehler, der als intransparent, unprofessionell und politisch riskant wahrgenommen wurde. Hinzu kommt die besondere Sensibilität des IKC-Projekts. Projekte religiöser oder identitätsbezogener Einrichtungen stehen oft unter verstärkter öffentlicher Beobachtung. Verzögerungen oder Unklarheiten werden nicht als technische Fragen gesehen, sondern als politische Entscheidungen. Je komplizierter die Abläufe der Verwaltung wirken, desto eher entsteht der Eindruck, es könne ein Interesse geben, Entscheidungen hinauszuzögern oder zu beeinflussen. Die Auseinandersetzung im Stadtrat selbst verschärfte die Lage weiter. Während Müller, Eigendorf und Raabe hartnäckig nachfragten, zeigte Vogt eine Mischung aus Verteidigungsbereitschaft und Unwillen, präzise Auskunft zu geben. Der Eindruck einer Informationsverweigerung mag nicht der Realität entsprechen, doch er entstand deutlich – und in der Politik zählt Wahrnehmung mindestens so viel wie Fakten. Ein weiterer Faktor war der Tonfall der Debatte. Die Kommunikation zwischen Oberbürgermeister und Stadtrat ist traditionell von professioneller Distanz geprägt, doch die Sitzung offenbarte eine ungewöhnliche Gereiztheit auf beiden Seiten. Zwischenrufe, Unterbrechungen und sarkastische Bemerkungen unterstrichen, dass das Vertrauen zwischen den Akteuren bereits vor der Sitzung belastet gewesen sein muss.
Ein dünner Ordner mit großer Wirkung
Die IKC-Affäre ist ein klassisches Beispiel dafür, wie Verwaltungsabläufe, politische Erwartungen und kommunikative Fehler ineinandergreifen können und aus einem vermeintlichen Detail ein politischer Konflikt entsteht, der weit über den ursprünglichen Anlass hinausweist. Ein unvollständiger Aktenordner mag administrativ erklärbar sein. Doch die Art, wie dieser unvollständige Ordner kommuniziert wurde – oder eben nicht –, wie Fragen beantwortet wurden und wie widersprüchliche Aussagen verschiedener Verwaltungseinheiten nebeneinanderstanden, hat den Konflikt verschärft. Am Ende ist die Affäre weniger ein Streit um fehlende Dokumente als eine Auseinandersetzung über Vertrauen, Verantwortlichkeit und Transparenz. Sie zeigt, wie fragil das Verhältnis zwischen Stadtrat und Verwaltung sein kann und wie wichtig klare Kommunikation in politisch sensiblen Verfahren ist. Ob die vollständigen Akten, die nachgereicht werden sollen, die offenen Fragen beantworten können, bleibt abzuwarten. Sicher ist jedoch, dass die politische Debatte über das IKC durch diese Vorgänge nicht beendet, sondern erst richtig entfacht wurde.








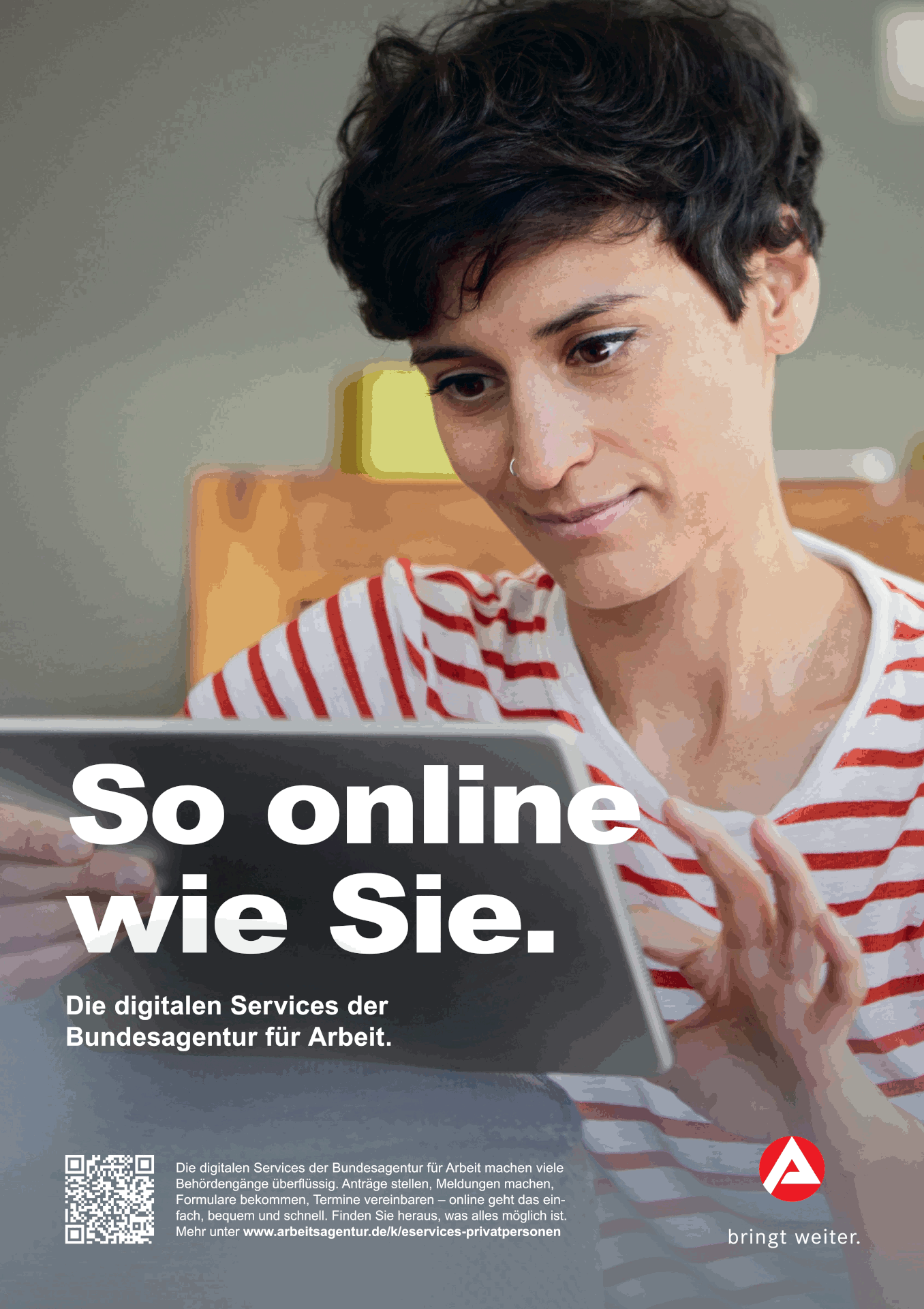

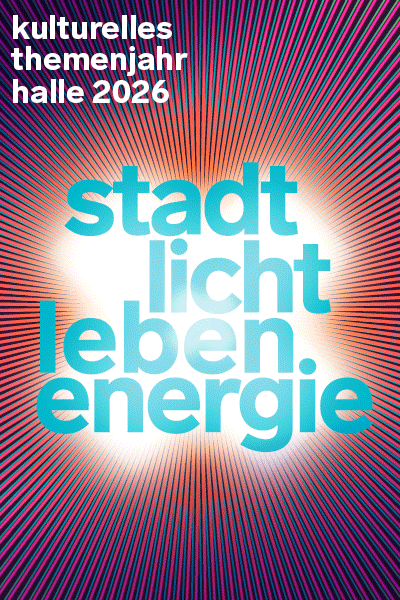

Sollte ich den Herrn Vogt doch zu Unrecht Friedrichs Münchhausen Syndrom unterstellt haben, dann bitte ich um Entschuldigung!
Erst im kommenden Herbst können diese Zustände einwandfrei beseitigt werden.
Soll heißen?
Überlege mal…
Du meinst, im kommenden Herbst kommt eine Regierung an die Macht, die nicht mehr transparent handelt und alle Fragen abblockt?
Möglicherweise eine , die sich für die Belange ihrer Bürger einsetzt 😉
Aber nur möglicherweise.
Interessant: Ist es jetzt anders?
Neugierig: War es jemals anders?
Ja, ist es in der Tat. Die Landesregierung beantwortet auch die merkwürdigsten Anfragen der Oppositionsfraktionen.
Nein.Nicht die SPD und Linke.
Ja, das hat Herr Talbeb A. beim Prozessbeginn wegen seiner Amokfahrt auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt auch deutlich gemacht. Und sogar noch aufgeschrieben und in die Höhe gehalten „Herbst 2026!“
Danke für diese sehr ausführliche und nachvollziehbare Darstellung.
Deswegen würde ich jetzt nicht unbedingt immer auf die Aussagen der Mitteldeutschen Zeitung vertrauen“, meinte Vogt“
Eine MZ ist darauf orientiert, seine Zeitung zu verkaufen und nicht an Wahrheit interessiert. Das hat man schon bei der Vorgehensweise mit OB Wiegand gemerkt. Jetzt ist wieder ein parteiloser OB gewählt und das Spiel geht von vorne los.
Mich interessiert viel mehr die Frage:
Wäre das gleiche Spektakel los, wenn es sich nicht um eine Moschee handeln würde? Frau Müller entfacht ja laut dieser Beschreibung ein regelrechtes Verhör. Ich finde es gut, dass gründlich vom OB geprüft wurde. Der erste Grundstücksverkauf wurde unter Geier durchgepeitscht
Hätte der OB nur geprüft und nicht verschleppt, hätten er und sein Büro nicht den Stadträten Unterlagen vorenthalten müssen.
Emmi, lass doch endlich Dein aus der Zeit gefallenes Gelaber um Herrn Wiegand. Das interessiert nun wirklich keinen mehr. Wenn der jetzige OB so gut geprüft hat, warum gibt es da keine nachvollziehbaren Belge? Und verschwundene Akten – das Problem kennst Du aus Deinem ehermaligen Wirkungsbereich ja wohl noch am Besten. Pippi läßt grüßen.
Das ausgedachte „Durchpeitschen“ beinhaltete einen Stadtratsbeschluss und somit ein geregeltes demokratisches Verfahren.
Herzlichen Glückwunsch Herr Vogt, jetzt haben sie ihr wahres Gesicht gezeigt! Ein nichts nützlicher Luftballon mit heißer Luft, mehr bist du nicht und nur durch einen Zufall oder Glück als OB gewählt worden. Bitte weiter so! Das macht es erst richtig spannend!!!
Wie? Du dachtest vorher anders von Vogt? Es war doch schon im Wahlkampf ersichtlich, dass da viel heiße Luft kommt und er nur auf billige emotionale Kampagne gegangen ist, um Wählerstimmen von naiven Stadtrandwählern zu bekommen. Ich hab’s vorhergesagt.
Es fällt auf, dass nur Müller, Eigendorf und Raabe ein Problem zu haben scheinen, die Räte der CDU, FDP, AfD und Hauptsache Halle scheinen da kein großes Drama draus zu machen. Ich finde, hier wird von besagten Stadträten aus einer Mücke ein Elefant gemacht, und ein Skandal herbeifabriziert, der eigentlich keiner ist oder sein müsste. Die Mehrheit der Stadtgesellschaft ist augenscheinlich entweder gegen ein islamistisches Kulturzentrum oder diesem gegenüber indifferent eingestellt. Nur ein paar Besserwisser machen daraus wieder eine Grundsatzdiskussion darüber, wer was wie gesagt hat, die mit dem eigentlichen Thema überhaupt nichts mehr zu tun hat.
Da fällt mir die Olsenbande ein !
Wenn hier aber rauskommt, dass der OB oder sein Mitarbeiter wissentlich eine Verzögerung angeleiert hat… Den Kontext mal vom IKC trennen. Wer weiß wo hier noch Akten unter Verschluss gehalten werden… Stell dir mal vor es wäre nicht das islamische Kulturzentrum sondern das deutsche Kulturzentrum 🙂 Die blauen Patrioten hätten keine Ruhe gegeben.
Tja, was soll man dazu sagen…
Es gibt zwei Möglichkeiten:
1.Das äußerst hochqualifizierte Referentenpersonal hat die Akten getuned und lässt den OB voll ins Messer laufen.
2. Der OB hat die Akten getuned und rennt mit eigener Kraft ins Messer.
So oder so wird es weh tun.
Hier wird wieder versucht, wie beim Vorgänger Wiegand, den OB zu diskreditieren. Vor allem aus der linken Ecke tut sich wieder eine Person besonders hervor. Mich wundert es sowieso , dass die noch am Tische sitzt und nicht in der Bahn nach Leipzig!
Dünne Akte wird moniert. Dazu kommt noch Dünnes aus der Ecke!
Letztlich geht es doch nicht um Alten oder die Zusammenarbeit zwischen ob und Stadtrat. Es geht um dieses radikal religiöse Zentrum, welches der OB eigentlich verhindern wollte. Womit? Mit Recht! Denn eine Mehrheit der Hallenser möchte das nicht. Und warum nicht? Weil damit massiv Grundrechte beschnitten und verletzt werden. Das ist der Kern. Und Frau Müller geht eben nicht nach 18:00 Uhr aus dem Haus, sie geht nicht auf die am besten bewachten Weihnachtsmärkte aller Zeiten. Eigentlich halte ich sie immer noch für eine kompetente Kommunalpolitikerin. Aber aus ihrem Dornröschenschlaf muss sie mal erwachen. Die Realität ist täglich spürbar. Und gerade die Linke sollte ein Interesse daran haben, nicht nur gegen politische Extremisten zu kämpfen, sondern auch, oder vor allem, religiöse.
Zum Beispiel beschneiden und verletzen sie das Grundrecht auf ungestörte Religionsausübung.
„Womit? Mit Recht“
Mit Recht hatte es schon mal nichts zu tun.
Wenn eine Behörde eine zustehende Genehmigung nicht erteilt, macht sie sich mindestens strafbar und irgendwann auch entschädigungspflichtig.
Du möchtest doch nicht in einer Bananenrepublik leben.
Woher kommt die Einschätzung des IKC als radikalreligiöse Zentrum? M. W. ist das Gegenteil der Fall, da finden Deutschkurse statt, es gibt eine Zusammenarbeit mit anderen Religionsgemeinschaften und ein sehr gutes Verhältnis zur halleschen Polizei.
Das klingt mir nicht nach Extremismus.
Hast du Belege für deine Behauptung?
Was du nicht sagst. Tanzen die auch drinne?
Lass mich raten:
1. Du warst noch nie im IKC, obwohl da jeder rein kann
2. Du hast noch nie mit dem Polizeibeamten gesprochen, der da sehr häufig anzutreffen ist und dessen Name mit Ch.. anfängt.
Warum muss da „sehr häufig“ ein Polizeibeamter hin?
Da „muss“ nicht sehr häufig ein Polizeibeamter hin.
Klare Botschaft: Jeder macht nur noch was er will. Dann mach ich jetzt einfach auch nur noch so wie ich will!