Zahl der Erwerbstätigen in Sachsen-Anhalt sinkt weiter auf 980.000
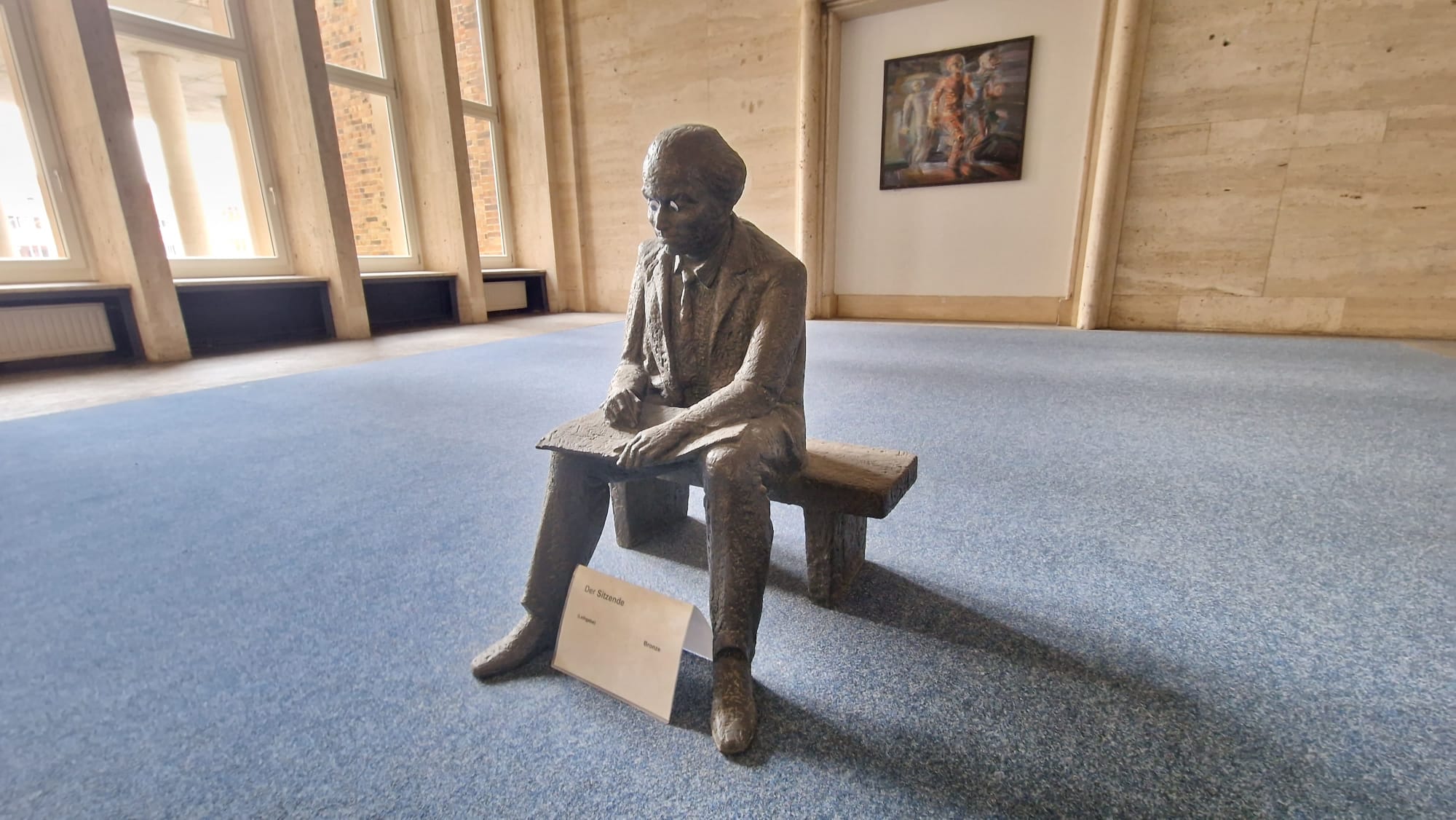
Im I. Quartal 2025 hatten 980,0 Tsd. Erwerbstätige ihren Arbeitsort in Sachsen-Anhalt. Das waren 5,2 Tsd. Personen bzw. 0,5 % weniger als im Vorjahresquartal. Wie das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt nach neuesten vorläufigen Berechnungen mitteilt, setzte sich damit der seit dem III. Quartal 2022 zu verzeichnende negative Trend weiter fort.
Gegenüber dem I. Quartal 2024 verringerte sich die Erwerbstätigkeit in fast allen Wirtschaftsbereichen Sachsen-Anhalts. Am stärksten sank sie im Produzierenden Gewerbe (-4,5 Tsd. Personen), insbesondere im Verarbeitenden Gewerbe (-3,4 Tsd. Personen). Auch in der Land- und Forstwirtschaft; Fischerei (-0,3 Tsd. Personen) und in den Dienstleistungsbereichen insgesamt (-0,4 Tsd. Personen) ging die Erwerbstätigenzahl zurück. Nur der Bereich Öffentliche und sonstige Dienstleistungen, Erziehung, Gesundheit; Private Haushalte (+2,6 Tsd. Personen) verzeichnete einen Anstieg.
In Deutschland sank die Erwerbstätigenzahl im I. Quartal 2025 erneut leicht gegenüber dem gleichen Vorjahresquartal und zwar um 60,0 Tsd. Personen (-0,1 %) auf 45,8 Mill. Personen. Sowohl in Westdeutschland ohne Berlin (-0,1 %) als auch in Ostdeutschland ohne Berlin (-0,6 %) gab es eine Abnahme. Die Spannweite der Veränderungsraten lag zwischen -1,0 % im Saarland und +0,6 % in Hamburg.
Gegenüber dem IV. Quartal 2024 ging die Zahl der Erwerbstätigen in Sachsen-Anhalt auch saisonbedingt um 14,2 Tsd. Personen zurück. Mit -1,4 % fiel die Abnahme genauso hoch aus wie in Ostdeutschland (ohne Berlin), jedoch stärker als im bundesweiten Durchschnitt (-0,9 %). Der Rückgang betraf alle Wirtschaftsbereiche Sachsen-Anhalts. Am stärksten sank die Erwerbstätigenzahl in den Bereichen Produzierendes Gewerbe (-3,8 Tsd. Personen), Handel, Verkehr, Lagerei, Gastgewerbe, Information und Kommunikation (-3,7 Tsd. Personen), Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleistungen; Grundstücks- und Wohnungswesen (-3,1 Tsd. Personen) sowie Öffentliche und sonstige Dienstleistungen, Erziehung, Gesundheit; Private Haushalte (-2,8 Tsd. Personen).
Zusätzlich zur Erstberechnung des I. Quartals 2025 wurden auch die bisher veröffentlichten Zahlen ab dem I. Quartal 2024 und das Jahresergebnis 2024 überarbeitet. Bei den hier vorgelegten Ergebnissen, die auf dem Rechenstand des Statistischen Bundesamtes vom Mai 2025 basieren, handelt es sich um Berechnungen des Arbeitskreises „Erwerbstätigenrechnung der Länder“ (AK ETR), dem alle Statistischen Ämter der Länder, das Statistische Bundesamt sowie der Deutsche Städtetag angehören.
Zu den Erwerbstätigen zählen alle Personen, die als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder als Selbstständige, einschl. deren mithelfenden Familienangehörigen, eine auf Erwerb gerichtete Tätigkeit ausüben.





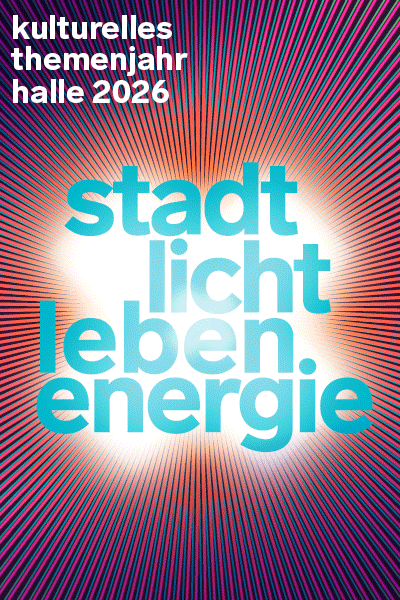
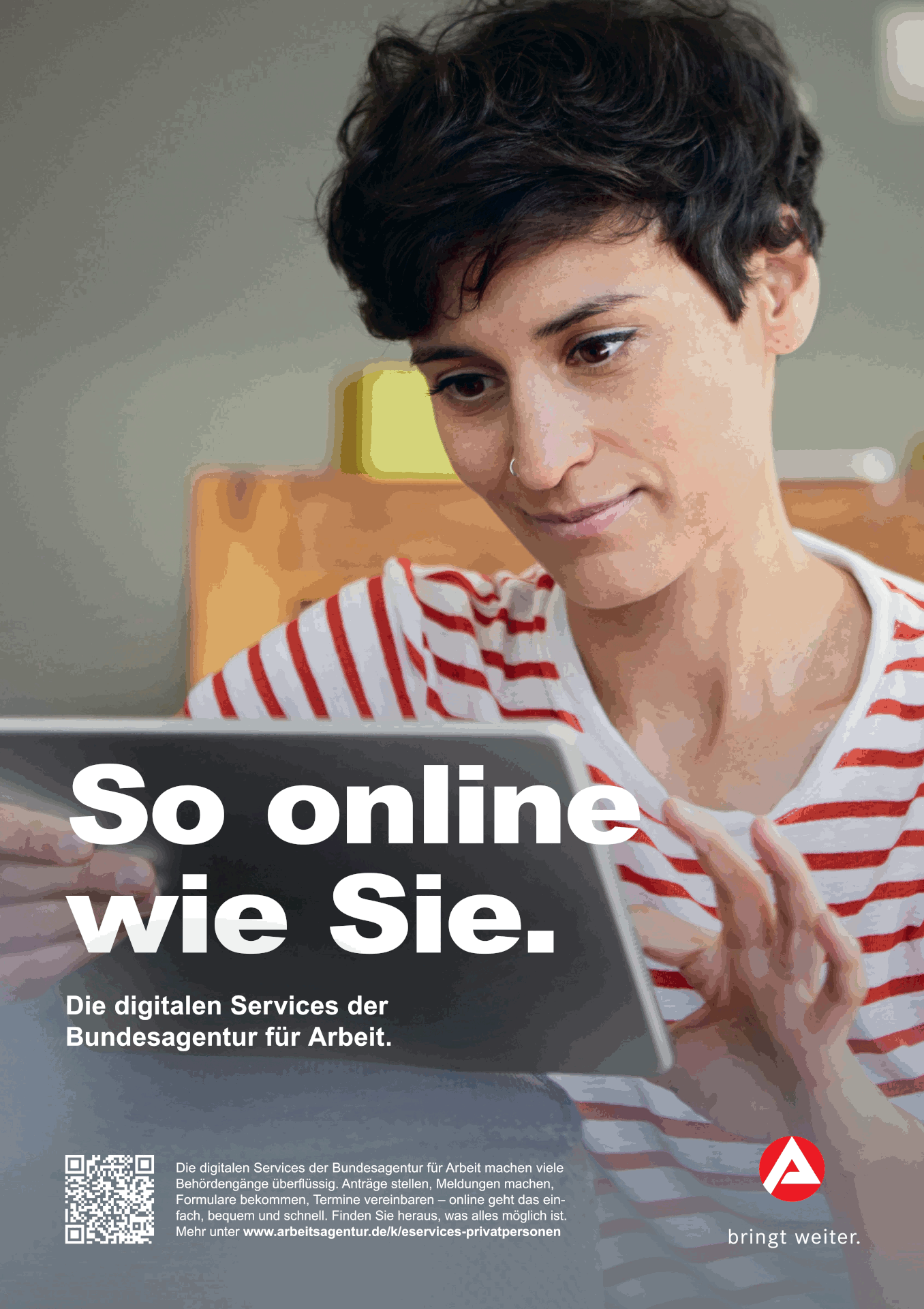




0,5 Prozent weniger. Wieviele Menschen sind in Rente gegangen ? Wieviele Arbeitnehmer sind verstorben ? 5.200 weniger Erwerbsttätige… Wie wäre es mit einer genaueren Darstellung. Wäre schön.
Die gibt es beim statistischen Bundesamt. Dort findest Du solche Daten.
Mit mehr Druck auf die Bürgergeldempfänger ließen sich die Beschäftigungszahlen wieder erheblich steigern. Hoffentlich wird das endlich mal den Regierenden bewusst.
@PaulusHallenser:
Zunächst wird in dem Beitrag keine Aussage darüber getroffen, warum und weshalb die Zahl der Erwerbstätigen gesunken ist. Theoretisch wären etwa Verrentung, Tod, Wegzug, konjunkturelle Schwäche als Gründe denkbar. Dass es für Sie aber einmal mal mehr die Bürgergeldempfänger:innen sein sollen, ist doch sehr merkwürdig. Man könnte meinen, Sie hätten sich auf diese Gruppe von Menschen eingeschossen.
Unabhängig davon ist Ihre These auch nicht ganz richtig. Wir erleben seit einiger Zeit bereits, dass der Druck auf Bürgergeldempfänger:innen steigt, sowohl von der Verschärfung der gesetzlichen Regelungen her, als auch was die öffentliche Debatte anbelangt. Einen signifikant positiven Effekt hinsichtlich der Arbeitsmarkintegration von arbeitssuchenden Menschen im Bürgergeld hat das jedoch mit Blick auf die Arbeitslosenstatistiken nicht (zumal nicht jeder Mensch, der Bürgergeld bezieht gleichzeitig auch arbeitslos ist).
Zwar ist es gemäß des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) richtig, dass sich Sanktionen ein Mittel sind, um die Mitwirkung der Leistungsberechtigten zu erhöhen (die meisten Sanktionen werden aufgrund von Meldeversäumnissen ausgesprochen) und auch durchaus eine beschleunigte Aufnahme einer Erwerbsarbeit zur Folge hat. Aber die Vermittlung erfolgt dann zumeist in niedrigentlohnte Beschäftigungsverhältnisse, auch dreht sich der Effekt langfristig um. Auch können Sanktionen u.U. sogar zu Sperren bei der Energieversorgung führen oder gar Wohnungsverlust drohen (Quelle: https://iab-forum.de/bedarf-es-schaerferer-leistungsminderungen-beim-buergergeld/). Mit anderen Worten: es besteht die Gefahr, dass man die Menschen in die Obdachlosigkeit drängt. Warum das skandalös und mit unserer Verfassung nicht zu vereinen ist, muss ich hoffentlich nicht weiter ausführen.
Überdies wirken Sanktionen – ich habe es angedeutet – auch indirekt, also ohne dass sie tatsächlich ausgesprochen werden. Sie haben einen disziplinierenden Effekt, sodass schlechte Arbeitsbedingungen und niedrig entlohnte Beschäftigung eher akzeptiert werden. Und dieser Effekt erstreckt sich auch auf die Bürgergeldbezieher:innen mit Arbeit und auch auf regulär Beschäftigte. Der disziplinierende Effekt wirkt im Übrigen auch durch die gesellschaftlich Stigmatisierung gegenüber Bürgergeldempfänger:innen wie Sie sie betreiben, denn man aktzeptiert lieber schlechte Arbeitsverhältnisse als zu riskieren, ins Bürgergeld rutschen zu können).
Leider verbreiten Sie mit Ihrer Aussage (wiederholt) die Misstöne der populistischen Kakophonie rund ums Bürgergeld, die jedoch von einer seriösen Einschätzung der Ursachen von Arbeitslosigkeit und deren wirksamer Bekämpfung weit entfernt sind.
Sie sagen zu Recht, dass Bürgergeldempfänger:innen nicht pauschal für sinkende Erwerbstätigenzahlen verantwortlich gemacht werden dürfen. Doch zugleich verengen Sie die Debatte meines Erachtens stark auf strukturelle Erklärungen und unterschätzen dabei den Einfluss individueller Verantwortung. Natürlich gibt es vielfältige Gründe für Arbeitslosigkeit – aber es gibt eben auch Menschen, die die Aufnahme einer zumutbaren Arbeit verweigern, obwohl entsprechende Angebote vorhanden sind. Dieser Aspekt sollte nicht tabuisiert werden.
Sie führen aus, dass verschärfte Regeln und Sanktionen keinen nachhaltigen Integrationseffekt hätten. Doch die Forschung ist hier differenzierter. Auch das von Ihnen zitierte IAB hat gezeigt, dass Sanktionen – sofern maßvoll eingesetzt – durchaus eine aktivierende Wirkung entfalten können. Dass viele Sanktionen aufgrund von Meldeversäumnissen erfolgen, deutet doch gerade darauf hin, dass es nicht nur systemische Probleme, sondern auch Defizite bei der Mitwirkung gibt. Wer staatliche Unterstützung erhält, sollte sich im Gegenzug auch aktiv um eine Verbesserung seiner Lage bemühen. Das ist eine Frage der Fairness gegenüber der Solidargemeinschaft.
Sie weisen darauf hin, dass Sanktionen Menschen in schwierige Lebenslagen bringen können, bis hin zur Obdachlosigkeit. Das ist ein ernstzunehmender Punkt. Aber umgekehrt gefragt: Was ist mit den Menschen, die trotz schwieriger Bedingungen arbeiten gehen, auch zu niedrigen Löhnen? Muss nicht auch deren Lebensleistung gewürdigt und geschützt werden – auch indem man klare Grenzen gegenüber jenen zieht, die sich dauerhaft auf Transferleistungen verlassen?
Es geht nicht (!) um Stigmatisierung, sondern um eine realistische, faire und differenzierte Diskussion. Wer nur die strukturellen Probleme sieht, ohne die individuelle Verantwortung anzuerkennen, läuft Gefahr, die Balance in der Sozialpolitik zu verlieren. Und das könnte langfristig dem sozialen Zusammenhalt schaden.
@So einfach ist das eben nicht: Zunächst freut es mich, dass Sie sich die Mühe gemacht haben, mir ausführlich und sachlich zu antworten. Vielen Dank dafür.
Gerne möchte ich auf Ihre Ausführungen eingehen.
Zunächst finde ich, dass wenn Sie von „So einfach ist das eben nicht.“ sprechen und dabei auf individuelle Verantwortlichkeit und somit letztlich den Willen als Erklärungsfaktor verweisen, Sie es doch gerade sind, der/die es sich einfach macht. Stukturelle Faktoren sind eben gerade vielfältig, interferieren, etc. Aber gut, zu Ihren Aussagen.
„…aber es gibt eben auch Menschen, die die Aufnahme einer zumutbaren Arbeit verweigern, obwohl entsprechende Angebote vorhanden sind. Dieser Aspekt sollte nicht tabuisiert werden.“
Ja, die gibt es. Deren Zahl ist jedoch verschwindend gering (man geht von ca. 16.000 Totalverweigerern aus). Interessanterweise dreht sich die öffentliche Debatte aber nahezu ausschließlich um diese Gruppe. Gleichwohl gilt schon jetzt, dass Sanktionen verhängt werden, wenn Menschen zumutbare Arbeit ablehnen. Im Übrigen wurden die Regelungen für die Zumutbarkeit durch die letzten gesetzlichen Anpassungen ausgeweitet (siehe zumutbare Arbeits- bzw. Pendelwege). Zur nachhaltigen Arbeitsmarktintegration der Betroffenen von Langzeitarbeitslosigkeit hat das Anziehen der Daumenschrauben jedoch mit Blick auf die Statistik offenkundig nicht beigetragen (auch darauf verweist das IAB).
In Anbetracht der Tatsache, dass die überwiegende Mehrheit der Bürgergeldbeziehenden ja arbeiten wollen, muss man sich ja fragen, woran es liegen könnte, wenn es offensichtlich nicht am fehlenden Willen scheitert. Insofern kommt man da mit Appellen an die individuelle Verantwortung offenkundig nicht weiter (ich weise auch nochmal auf den Punkt hin, dass viele Menschen, die Bürgergeld beziehen, einer Erwerbstätigkeit nachgehen, jedoch aufstockende Leistungen aus dem Bürgergeld in Anspruch nehmen müssen).
„Was ist mit den Menschen, die trotz schwieriger Bedingungen arbeiten gehen, auch zu niedrigen Löhnen? Muss nicht auch deren Lebensleistung gewürdigt und geschützt werden – auch indem man klare Grenzen gegenüber jenen zieht, die sich dauerhaft auf Transferleistungen verlassen?“
Ja, ich bin völlig bei Ihnen, diese Leistungen müssen gewürdigt werden – aber bitte adressieren diese Appelle an jene, die auf die Entlohnung und die Arbeitsbedingungen direkten Einfluss haben, nämlich die Arbeitgeberseite.
Könnten Sie mir zudem bitte noch erläutern, wodurch es jenen im Niedriglohnsektor mit schlechten Arbeitsbedingungen besser gehen soll, wenn Arbeitslose im Bürgergeldbezug sich einem noch strengeren Sanktions- und Disziplinar-Regime ausgesetzt sehen würden?
Da weiterer Druck auf Menschen im Bürgergeldbezug ebendiese verstärkt in niedrig entlohnte und schlechte Arbeitsverhältnisse drängt, wird eher umgedreht ein Schuh daraus. Denn das Sanktions- und Disziplinarregime trägt nachweislich zur Aufrechterhaltung des Niedriglohnsektors bei. Insofern wäre all jenen Beschäftigten mehr geholfen, wenn diese Arbeitsverhältnisse indirekt nicht weiter aufrechterhalten würden.
„Wer nur die strukturellen Probleme sieht, ohne die individuelle Verantwortung anzuerkennen, läuft Gefahr, die Balance in der Sozialpolitik zu verlieren. Und das könnte langfristig dem sozialen Zusammenhalt schaden.“
Mit der Einführung von Hartz-IV wurde das Problem der Arbeitslosigkeit zunehmend zu einem individuellen Problem verklärt. Früher war es – salopp gesagt – die Haltung, dass Arbeitslosigkeit in Abhängigkeit von Konjunkturzyklen und wirtschaftlichen Strukturwandel potentiell jede:n treffen könnte (siehe etwa durch den Ausstieg aus der Kohleverstromung). Die Antwort der Arbeiterbewegung war jeher kollektive Solidarität durch einen statussichernden Sozialstaat, der Arbeitslosigkeit gerade nicht individualisiert, sondern bei dem die Solidargemeinschaft den/die Einzelne/n am Ende auffängt und den sozialen Status (Lebensleistung) sichert.
Mit der Einführung von Hartz-IV hat sich dieses Solidaritätsverständnis grundlegend gewandelt. Der statussichernde und Lebensleistung anerkennende Sozialstaat gehörte fortan der Vergangenheit an. Stattdessen galt nunmehr: solidarisch ist nicht, wer andere auffängt, sondern derjenige, der der Allgemeinheit nicht zur Last fällt. In der Folge wurde das Problem der Arbeitslosigkeit individualisiert und die Verantwortlichkeit hierfür nicht mehr in wirtschaftlichen Faktoren gesehen, sondern nahezu ausschließlich den Betroffenen selbst zugeschrieben. Insofern würde ich Ihnen entgegnen, dass es gerade das Problem ist, dass im Kontext der politischen Debatte ums Bürgergeld, strukturelle Faktoren systematisch ausgeblendet werden.
Der größte Teil (mehr als 2/3) der Bürgergeldempfänger sind Kinder, Leute deren Einkommen nicht ausreicht und die aufstocken müssen, oder die schlicht im Moment nicht arbeiten können weil sie gerade in einer Maßnahme stecken.
Aber Fakten werden von euch Hetzern gern ignoriert.
Wer sagt denn, dass diese kritsiert werden?
Sozialneid, der nach unten gerichtet ist, ist die widerlichste Form von Zynismus und Hetze, Paulus.
Was ist los mit dir? Seit wann bist du ein Feind von Freiheit?