„Das Planarchiv der Franckeschen Stiftungen“: Buch mit über 300 Jahren alten Plänen veröffentlicht

Über 3.382 Baupläne seit dem Beginn bis heute verfügen die Franckeschen Stiftungen. Und die Herausragendsten aus dem 18. Jahrhundert gibt es jetzt auch als Buch. Für 44 Euro ist es im Verlag der Franckeschen Stiftungen erschienen.
Das Planarchiv sei mit den Überlieferungen großer und weltberühmter Schlossbauten der Frühen Neuzeit wie Versailles und Sanssouci in Menge, Qualität und inhaltlicher Dichte vergleichbar, sagte Autor und seit neuestem Chef des Archivs, Dr. Thomas Grunewald. Wie er sagte, habe man sich schon seit der Vorbereitung für den UNESCO-Weltkulturerbe-Antrag vor über 10 Jahren auch schon mit dem Gedanken, ein Buch zu veröffentlichen, damit die Erkenntnisse nicht verloren gehen. Selbst Bau- und Reparaturkosten sind aufgeschlüsselt.
Zunächst mit Bleistift und danach mit Tinte und Tusche sind die Pläne illustriert worden. “Die Farbigkeit ist dabei nicht beliebig”, betont Grunewald. Die Außenmauern seien rosa dargestellt, Fachwerk in gelb. Die Ursprungidee stammt aus dem französischen Militär. Bei den Franckeschen Stiftungen wurde das Prinzip auch erstmals für Zivilgebäude umgesetzt. “Es ist die erste konkrete Umsetzung auf dem Feld des Zivilbaus”, betont Grunewald.
Der Bildband zeigt exemplarische Funde und Befunde aus dem Planarchiv in neun Kapiteln. Zunächst ordnet er das Plankonvolut im Hinblick auf seine kulturhistorische Bedeutung ein. Das zweite Kapitel weitet den Blick auf die Gebäude außerhalb des Geländes am heutigen Franckeplatz. Kapitel drei ist den Bauverwaltern gewidmet, die in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts das Baugeschehen an den Stiftungen prägten. Die Dichte und der Variantenreichtum der Zeichnungen erlaubt es, ihre Arbeitsweisen detailliert nachzuvollziehen. Typisch für die Stiftungsbauten waren von Beginn an die ständigen Umnutzungen, die mit vielfältigen Umbauten einhergingen. Die vorbereitenden Überlegungen und Varianten zeigt das Kapitel vier anhand des Umbaus der »Güldenen Crone« in Halle/Glaucha, einem Wohngebäude, das für die Produktion und den Handel mit Medikamenten erweitert werden sollte. Auch die organisatorischen und pädagogischen Belange der Schulstadt lassen sich mit Hilfe des Planarchivs bis ins Detail rekonstruieren. Das wird im Kapitel fünf beispielhaft an Dokumenten zu Betten, Toiletten, Schulzimmern und ihren Möbeln aufgezeigt. Denn in den Plänen wurden auch detaillierte Zeichnungen zu den Einrichtungsgegenständen vorgenommen – von der Gestaltung bis zur Aufstellung. “Dokumentiert ist also auch die Nutzung der Pläne im Voraus”, so Grunewald, “das ist sonst aus dieser Zeit nicht bekannt.” So gibt es dadurch heute Pläne, wie damals die Betten und die Schulbänke gestaltet waren.
Die stiftungseigenen Wirtschaftseinrichtungen, wie die Medikamentenexpedition, die Papiermühle, ein Bergwerk etc., nimmt Kapitel sechs in den Blick. So verfügten die Stiftungen über ein eigenes Erzbergwerk in Hessen, in dem Kupfer abgebaut wurde. Nach 20 Jahren wurde es aber weiterverkauft. Heute befindet sich dort ein See, erklärt Grunewald. Für die “Glauchschen Anstalten” war das neben Spenden, Buchladen und Apotheke eine weitere Einnahmequelle. Selbst Seide wurde einst hier produziert. Das geht aber auf Friedrich den Großen zurück. Der wollte die Seide für die Uniformen nicht teuer im Ausland einkaufen und hat deshalb im ganzen Reich die Waisenhäuser verpflichtet.
Kapitel sieben wirft einen Blick in das Archiv und zeigt die enge Verbindung der Baurisse und Zeichnungen mit den historischen Bauakten. Kapitel acht stellt anhand des Langen Hauses ein frühneuzeitliches Gebäudemanagement vor.
Im letzten Kapitel werden Entwürfe nicht errichteter Gebäude vorgestellt. Und davon gibt es einige. Beispielsweise sollte ein Holzstallgebäude zwischen Druckerei und Bau- und Bachhaus am Schwarzen Weg errichtet werden, so Grunewald. Pläne aus dem Jahr 1752 zeigen ein Ein- und ein Zweigeschossiges Gebäude Doch beide Ideen wurden nie umgesetzt, heute gibt es an der Stelle eine kleine Parkanlage.
Für Grunewald ist das Buch “mehr als ein Bildband. Man erfährt viel über das Bauen im 18. Jahrhundert.”




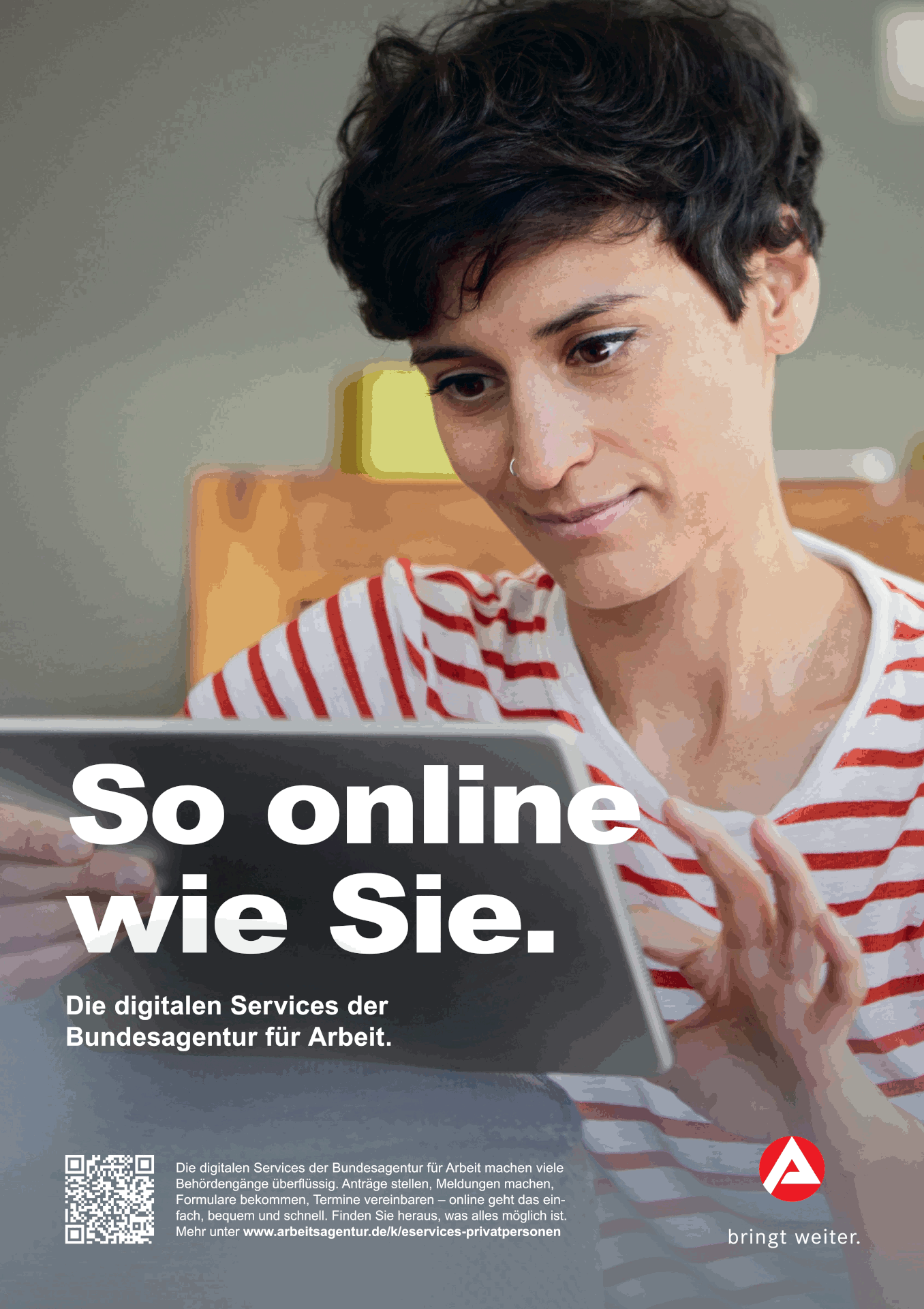






Neueste Kommentare