Mediziner aus Halle entwickeln Strategie für an Krebs Erkrankte in der Corona-Pandemie

Mit dem Umgang von Krebskranken in der Corona-Krise beschäftigt sich ein Forschungsprogramm an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Dabei werden die medizinischen, ethischen und psycho-sozialen Auswirkungen der Pandemie-Maßnahmen auf Tumorpatienten erforscht. Zudem geht es um die Entwicklung klinisch-ethischer Handlungsempfehlungen zur Prioritätensetzung der Krebsversorgung in Zeiten der Pandemie. Das Projekt CancerCOVID wird vom Hallenser Medizinethiker Prof. Dr. Jan Schildmann koordiniert und mit rund 400.000 Euro vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert.
„Als im März und April dieses Jahres die Anzahl von Intensivbetten und Beatmungsgeräten im Zentrum der Aufmerksamkeit stand, stellte sich für viele Patientinnen und Patienten mit Krebserkrankungen in Deutschland die Frage, wie es für sie weitergeht“, so Schildmann. Dank der zügigen und engen Zusammenarbeit von Fachgesellschaften konnten zeitnah Empfehlungen für die Krebstherapie unter den Bedingungen der Pandemie entwickelt werden.
Bislang sei jedoch unklar, welche Folgen die vorsorgliche Konzentration des Gesundheitssystems auf die Pandemie auf die Qualität der Versorgung von an Krebs erkrankten Patienten hatte. Gleiches gelte für die psychischen und sozialen Auswirkungen der Pandemie-Maßnahmen auf an Krebs erkrankte Menschen und deren Angehörige. Diese Wissenslücken zu schließen und klinisch-ethische Empfehlungen für die Prioritätensetzung im Kontext der Pandemie zu entwickeln, sei ein Ziel des Forschungsverbunds CancerCOVID. „Ich freue mich daher sehr, dass auf der Grundlage von gemeinsamen Vorarbeiten mit Versorgungsforscherinnen und -forschern aus Dresden und Onkologinnen und Onkologen aus Bochum dieses Forschungsvorhaben in sehr kurzer Zeit entwickelt werden konnte“, sagt Schildmann.
CancerCOVID gliedert sich in zwei Abschnitte. „Zunächst einmal werden wir Daten zur Versorgung von an Krebs erkrankten Patientinnen und Patienten im März und April 2020, auch im Vergleich zu den Vorjahren, auswerten. Im zweiten Schritt werden wir die vorliegenden Informationen mit Expertinnen und Experten aus der Krebsmedizin sowie weiteren Vertretern aus dem Gesundheitswesen und der Politik mit Blick auf mögliche Konsequenzen für eine begründete Prioritätensetzung in der Krebsmedizin diskutieren“, so Schildmann weiter.
Daraus sollen Handlungsempfehlungen abgeleitet werden. Deren Veröffentlichung sei zum Ende des 18-monatigen Projekts geplant und soll dazu dienen, in Ausnahmesituationen wie der Corona-Pandemie die akute, aber auch psycho-soziale Versorgung von Krebspatientinnen und Patienten zu gewährleisten.










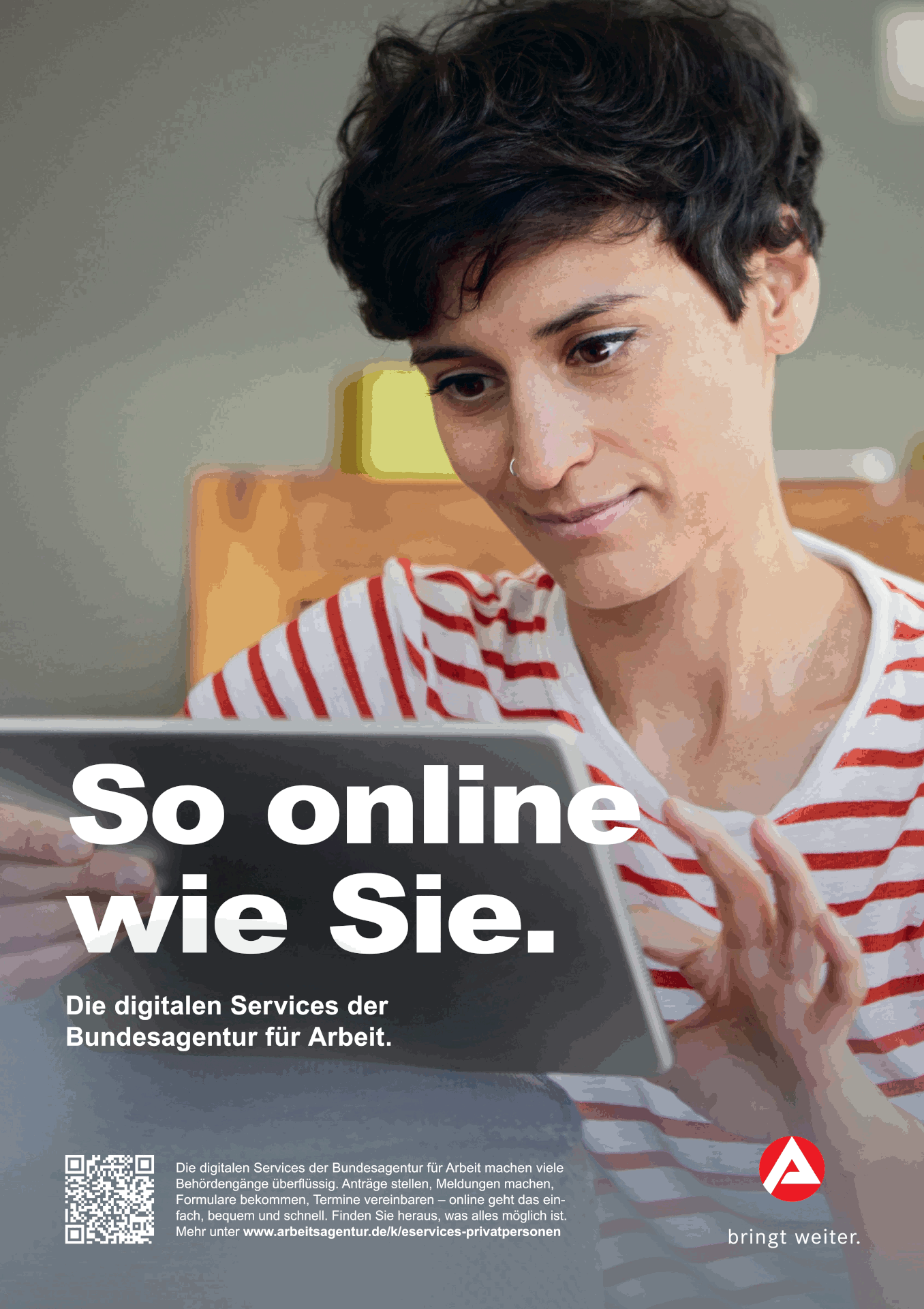
Neueste Kommentare