Zukunft der Datenspeicherung: Merz erlebt beim Max-Planck-Institut in Halle (Saale), wie Spintronik technologische Grenzen verschiebt

Am Montag stand die Stadt Halle (Saale) im Zentrum der nationalen Wissenschaftspolitik, denn Bundeskanzler Friedrich Merz besuchte das renommierte Max-Planck-Institut (MPI) für Mikrostrukturphysik, um sich ein Bild davon zu machen, wie essentielle Grundlagenforschung den Weg für technologischen Fortschritt und wirtschaftliche Innovationen ebnet. Der Besuch unterstrich die zentrale Bedeutung der wissenschaftlichen Exzellenz der Max-Planck-Gesellschaft (MPG) für die Zukunft Deutschlands und Europas. Das MPI für Mikrostrukturphysik in Halle ist ein Brennpunkt der Forschung an neuartigen Materialien und Verfahren. Die hier gewonnenen Erkenntnisse sind darauf ausgerichtet, die bisherigen Grenzen in Schlüsselbereichen wie der Datenspeicherung und -verarbeitung zu überwinden – eine technologische Notwendigkeit im digitalen Zeitalter.
Die Brücke von der Erkenntnis zur Anwendung
Der Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse in konkrete industrielle Anwendungen ist unverzichtbar, um nachhaltiges wirtschaftliches Wachstum zu generieren. Obwohl die Max-Planck-Gesellschaft weltweit für ihre exzellente Grundlagenforschung bekannt ist, belegen zahlreiche Beispiele, dass diese Forschung regelmäßig zu hochanwendbaren und gesellschaftlich relevanten Ergebnissen führt. Erkenntnisse aus der MPG haben Technologien geprägt, die heute global genutzt werden und unseren Alltag tiefgreifend beeinflussen: Das Softwareprogramm FLASH machte die Magnetresonanztomographie (MRT) erst praxistauglich und revolutionierte die medizinische Diagnostik. Darüber hinaus kann eine vollkommen neue Generation von Lichtmikroskopen Moleküle auf Nanoebene sichtbar machen und eröffnet neue Fenster in die Zellbiologie. Nicht zuletzt hat die Entwicklung der Genschere CRISPR-Cas unlängst zur ersten zugelassenen Gentherapie gegen die Sichelzellanämie geführt, was die Heilungschancen für Betroffene massiv verbessert. Grundlagenforschung ist somit der Motor, der Lösungen für medizinische, gesellschaftliche, ökonomische und technologische Herausforderungen schafft.
Technologie-Transfer im Aufwind
Max-Planck-Präsident Patrick Cramer betonte die verstärkten Anstrengungen der Gesellschaft im Bereich des Techtransfers: „Die Max-Planck-Gesellschaft betreibt Spitzenforschung, aber sie baut auch ihr Engagement beim Techtransfer weiter aus. In diesem Jahr haben wir bereits zwölf Ausgründungen an den Start gebracht.“ Ein herausragendes Beispiel für den Erfolg dieser Transferstrategie ist das Kernfusions-Start-up Proxima Fusion aus dem Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, das eine Rekordfinanzierung von über 130 Millionen Euro einwerben konnte und damit das internationale Vertrauen in die wissenschaftlichen Ideen „Made in Germany“ unterstreicht. Die MPG gehört zudem zu den Top Ten der europäischen Forschungseinrichtungen, die die meisten akademischen Patentanmeldungen in Europa vorweisen können, was ein klarer Indikator für die hohe Anwendungsrelevanz und das Innovationspotenzial ist. Bundeskanzler Friedrich Merz äußerte sich mit Blick auf die Verwertung wissenschaftlicher Durchbrüche besorgt über die Abhängigkeit von externen Kapitalgebern: „Wir müssen dringend dafür sorgen, dass wir das, was wir hier in Forschung und Entwicklung erreichen, zu dem Zeitpunkt, wenn es in die Praxis geht, wenn es in die Umsetzung geht, wenn es in die Skalierung geht, dass wir dafür die Finanzierung nicht aus den USA oder anders woher bekommen, sondern aus Europa.“ Die Sicherung der Finanzierung innerhalb Europas sei ein Schlüssel zur Wahrung der technologischen und wirtschaftlichen Souveränität.
Stuart Parkin: Der Brückenbauer der Spintronik
Ein leuchtendes Beispiel dafür, wie Grundlagenforschung und Anwendung ineinandergreifen, ist Stuart Parkin, Geschäftsführender Direktor des MPI für Mikrostrukturphysik. Der international renommierte britische Physiker vereint in seiner Arbeit explorative Forschung und unmittelbare industrielle Relevanz. Parkin hält mehr als 129 erteilte Patente und wurde 2014 mit dem mit einer Million Euro dotierten Millennium-Technologiepreis ausgezeichnet – eine Ehre, die er mit Größen wie Tim Berners-Lee teilt. Viele seiner patentierten Arbeiten konzentrieren sich auf das Feld der Spintronik, und dank seiner Erfindungen konnte die Datendichte auf Festplatten um das 1000-fache erhöht werden. Diese bahnbrechenden Fortschritte ermöglichten erst die heutigen Computer Clouds und die Speicherung riesiger Datenmengen. Parkins aktuelles Forschungsprogramm zielt darauf ab, hochinnovative und bahnbrechende Technologien direkt in Deutschland zu entwickeln und damit die technologische Souveränität Deutschlands und der EU in diesem kritischen Sektor zu stärken.
Zukunftstechnologien durch die Hightech Agenda
Im Zuge des Kanzlerbesuchs sicherte die Max-Planck-Gesellschaft ihr Engagement bei der Umsetzung der Hightech Agenda Deutschland zu, insbesondere im Bereich der Mikroelektronik. Hier steht Parkin federführend hinter dem Konzept für die Initiative Spintronics+, die von Max-Planck vorgeschlagen wurde. Diese Initiative soll an neuen Verfahren und Technologien für deutlich leistungsfähigere Chips forschen, da die Miniaturisierung der konventionellen CMOS-Technologie zunehmend an physikalische Grenzen stößt und weitgehend ausgereizt ist. Dies eröffnet Chancen für alternative Architekturen auf Basis neuartiger physikalischer Prinzipien, denn ohne Grundlagenforschung gibt es keine Anwendertechnologien von morgen.
Spintronics+: Die Forschungsinhalte
Die Initiative Spintronics+ soll die Zukunftstechnologien Spintronik und 3D-Racetrack-Speicher als ultraschnelle, energiearme Hochdichtespeicher erforschen. Darüber hinaus stehen neuromorphe Architekturen auf Spin- und Ionenbasis, 2D-Quantenmaterialien mit neuen spintronischen und optoelektronischen Funktionen sowie hybride Spin-Photonen-Plattformen für das Quantencomputing im Fokus. Diese Technologien werden in einem integrierten Forschungs- und Entwicklungsansatz vorangetrieben. Um Forschung und industrielle Anwendung zu beschleunigen, sollen in Halle robotergesteuerte Labore zum Einsatz kommen, welche atomar präzise Dünnschichtabscheidung, fortgeschrittene Charakterisierungsmethoden und maschinelles Lernen kombinieren. Das Ziel ist es, Entwicklungszyklen zu verkürzen und Prototypen von neuromorphen und 3D-Speichersystemen im Wafermaßstab zu entwickeln. Durch starke nationale Partnerschaften soll so die technologische Souveränität Deutschlands gestärkt werden, unabhängig von anderen geopolitischen Akteuren, und die Produktion innerhalb des Landes ausgebaut werden.
Foto: Sebastian Willnow / MPI für Mikrostrukturphysik





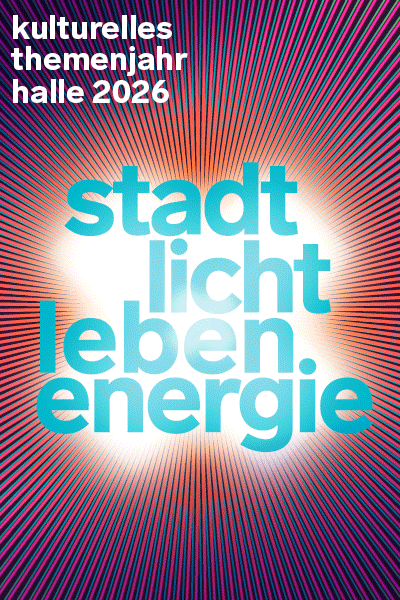




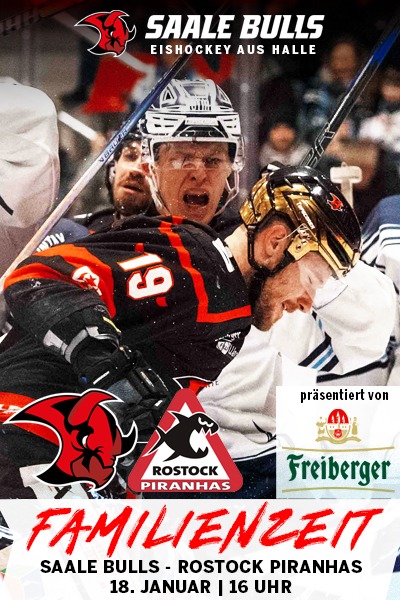
Während hier gefeiert wird, dass ein paar Wissenschaftler Spintronik ausprobieren, haben wir in vielen Bereichen den Anschluss verpasst.
E‑Autos hinken hinter anderen Ländern her,
Künstliche Intelligenz wird nur langsam umgesetzt,
die Kernkraft wurde abgeschaltet,
Wasserstofftechnologie ist noch nicht flächendeckend verfügbar,
Digitalisierung in Behörden läuft nur schleppend,
Bildungssystem zeigt stagnierende Ergebnisse,
Energiewende verzögert sich,
5G-Ausbau liegt hinter anderen Ländern zurück,
selbst in Hightech-Forschung ist die Umsetzung von Innovationen oft langsam.
Beim Gasspeicherstand gibt es ebenfalls deutliche Probleme.
Wir stehen vor ernsten Problemen und feiern gleichzeitig ein paar Laborprojekte…
Lächerlich dieser Kanzler und dieses Kartell an Altparteien
Schon Honnecker hat sich vor Jahrzehnten die Zukunft der Datenspeicherung angeguckt: Den 1-Megabit-Chip aus eigener Fertigung.